Diese vorangestellte Diskussion lohnt sich nicht durchzuschauen. Ich gebe an dieser Stelle dementsprechend keine Empfehlung ab, dies zu tun.
Trotzdem will ich einen kleinen Kommentar hierzu niederschreiben:
Wer auf die Frage, ob unsere Gesellschaft überhaupt Milliardäre braucht -unabhängig, ob diese Frage nun überhaupt sinnvoll sei – mit Einwänden reagiert, wie „ja, wenn sie Arbeitsplätze schaffen“ oder „man könnte sie gar nicht stärker besteuern, wenn ihr Vermögen in Kapital gebunden ist“, zeigt nur die eigene Fantasielosigkeit auf.
Denn das Unternehmen unter dem Privateigentum ist überhaupt nicht notwendig.
Dass über einem Konzern der Milliardär steht, ist lediglich eine historische Besonderheit und nicht einmal mehr so gängig.
Man könnte sich dagegen jedoch ebenso gut Räte vorstellen oder angestellte, eingesetzte oder gewählte Direktionen.
Insbesondere der Manager als Charaktermaske oder die Aktiengesellschaft sind immerhin schon heute längst bekannt, auch, wenn sich gerade unter letzterer die Milliardäre im besonderen Maße tummeln.
Im Gegenteil aber – und das ist gerade der springende Punkt an der Sache – sind vor Allem jene Einzelpersonen, die Arbeitsplätze „schaffen“, ein viel größeres Problem für die Demokratie als der hedonistische Prinz ohne gesellschaftliche Ambitionen.
Denn: Erstere verfügen über existenzielle Druckmittel mit Erpressungspotential gegen Politik und Arbeiterschaft.
Der Dekadente lediglich moralische Projektionsfläche.
Soziales Engagement und gesellschaftliche Teilhabe stattdessen, machen die Reichen erst so mächtig.
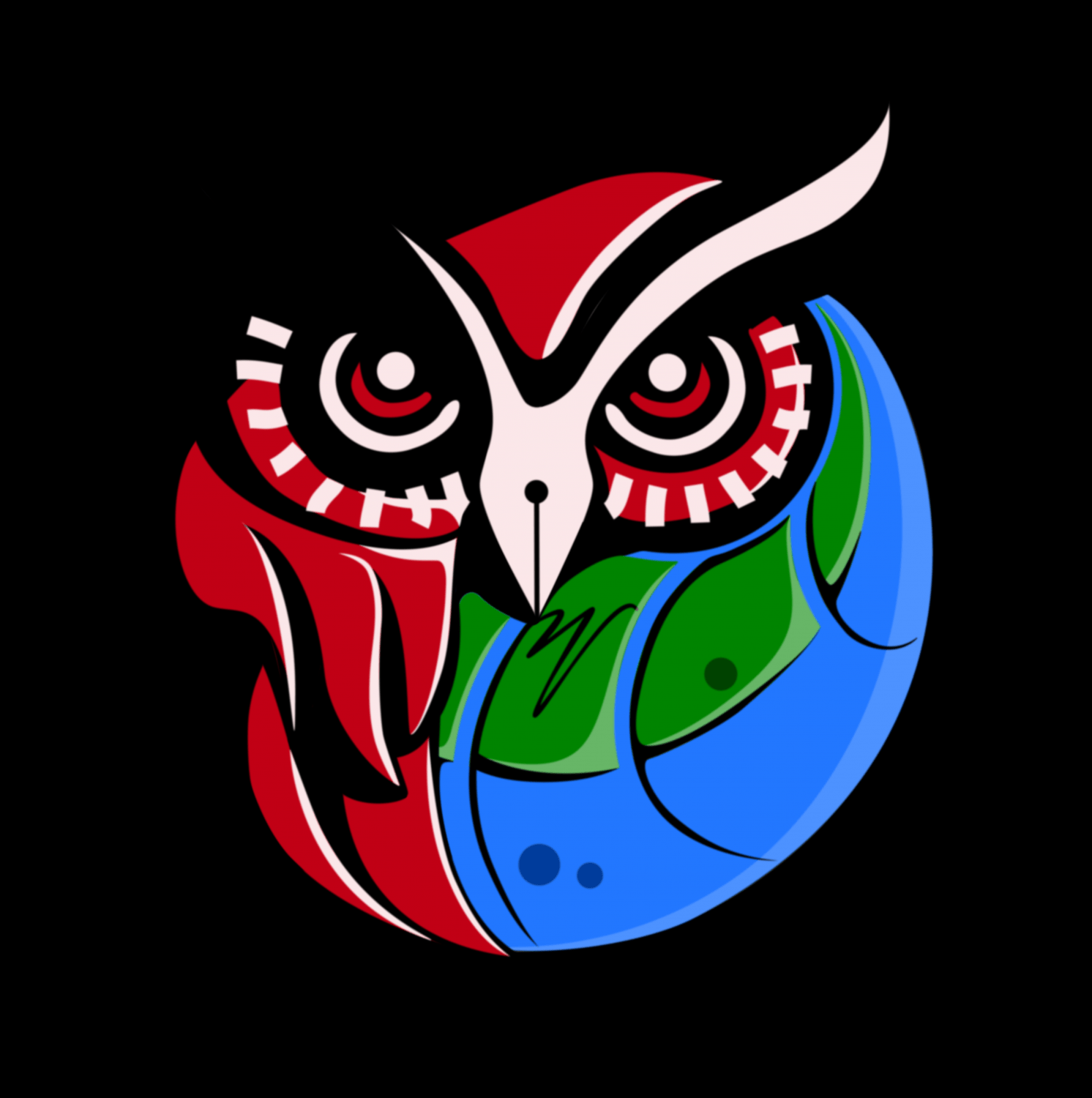

Schreibe einen Kommentar