Das Demokratieverständnis der Sozialdemokratie:
Im August 2022 implizierte Andrea Nahles von der SPD zu der Frage, was von einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne in Zeiten kriegsbedingter Energieknappheit zu halten wäre, dass dies in einer Demokratie keine Option sei.
Unabhängig, ob diese Aussage nun selbst geglaubt und eingehalten wurde, zeigt sie auf, wie tief ein gewisses (falsches) Demokratieverständnis in der Mehrheitspolitik, insbesondere in der Sozialdemokratie unserer Zeit verankert ist.
Wohlgemerkt handelt es sich hierbei nicht um ein gefordertes Profitverbot, sondern eine Beschneidung desselben.
Ähnliche Aussagen lassen sich konsequenterweise in verstärkter Form finden zum Thema Enteignung und Vergesellschaftung in genere.
Was hier zum Ausdruck kommt ist eine versteckte Annahme, die den liberalen Demokratien, dem fortschrittlichsten, was unserer Weltgesellschaft bislang hervorzubringen gelungen war, innewohnt:
Eigentum und Markt sind, neben Parlament – Regierung und Opposition – und unabhängigen Gerichten, fundamentale demokratische Institutionen mit ideellem Verfassungsrang.
Diese Gewissheit hat sich so stark festgesetzt, dass es irritiert, dass in der klassischen Institutionenlehre dies kaum Erwähnung findet.
Der Markt aber ist nicht demokratisch.
Er ist schlechtensinnes anarchistisch zwischen seinen betrieblichen Einheiten organisiert, innerhalb dieser mit Kommando- oder imitierten Familienstrukturen ausgestattet, im Ganzen mit Tendenz zur Bandenherrschaft und im Laufe der Evolution zur Diktatur neigend.
Der bürgerliche Staat, demokratisch oder autoritär geführt, hat die Aufgabe, dieser Tendenz entgegenwirkend, die ursprüngliche Anarchie aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, ohne den Markt selbst, als ökonomische Quelle seiner Macht, zu hintergehen.
Diese Aufgabe, der korrektiven Intervention, erfüllt er mal besser und mal schlechter.
Nur in dieser Dynamik allerdings, noch unter der Herrschaft eines demokratischen Staates, der dieser, seiner Aufgabe auch nachkommt, erscheint der Markt selbst als demokratisch.
Einzig: Er ist es nicht.
Republikanische Debatten in Zeiten der Revolutionen, in Zeiten der Bekämpfung der alten Ständegesellschaften, haben sich immer auch die Frage gestellt, wie gesamtgesellschaftliche Arbeit organisiert werden kann.
Die soziale Frage war immer auch eine Frage der ökonomischen Basis, eine Frage nach Markt, Plan oder Assoziation.
Dass mittlerweile selbst der billigste staatliche Interventionismus sozial-marktwirtschaftlicher Prägung von sich selbst so verstehenden Sozialdemokraten als undemokratisch vom Tisch gefegt wird, ist die lächerliche Überspitzung einer Ideologie, die Mark Fisher kapitalistischen Realismus nennt.
Es wird Zeit, neu über Institutionen nachzudenken, über Rahmenbedingungen von Gesellschaft, von Verfassung und Demokratie.
Es ist hierbei der Spagat zu schaffen den Markt und seine Basis des Privateigentums an Produktionsmitteln soweit einzuschränken, dass er als Basis nicht mehr über die demokratischen Gesellschaften hinweg wirken kann, ohne den gewaltvollen paternalistisch-realsozialistischen Diktaturen, dessen Urbild das stalinsche Lagersystem bildet, entgegenzukommen.
Die Weltrepublik, als wirkliche Demokratie, kann nur sein, wenn sie global, klassenlos und Ihre Regierung wählbar ist.
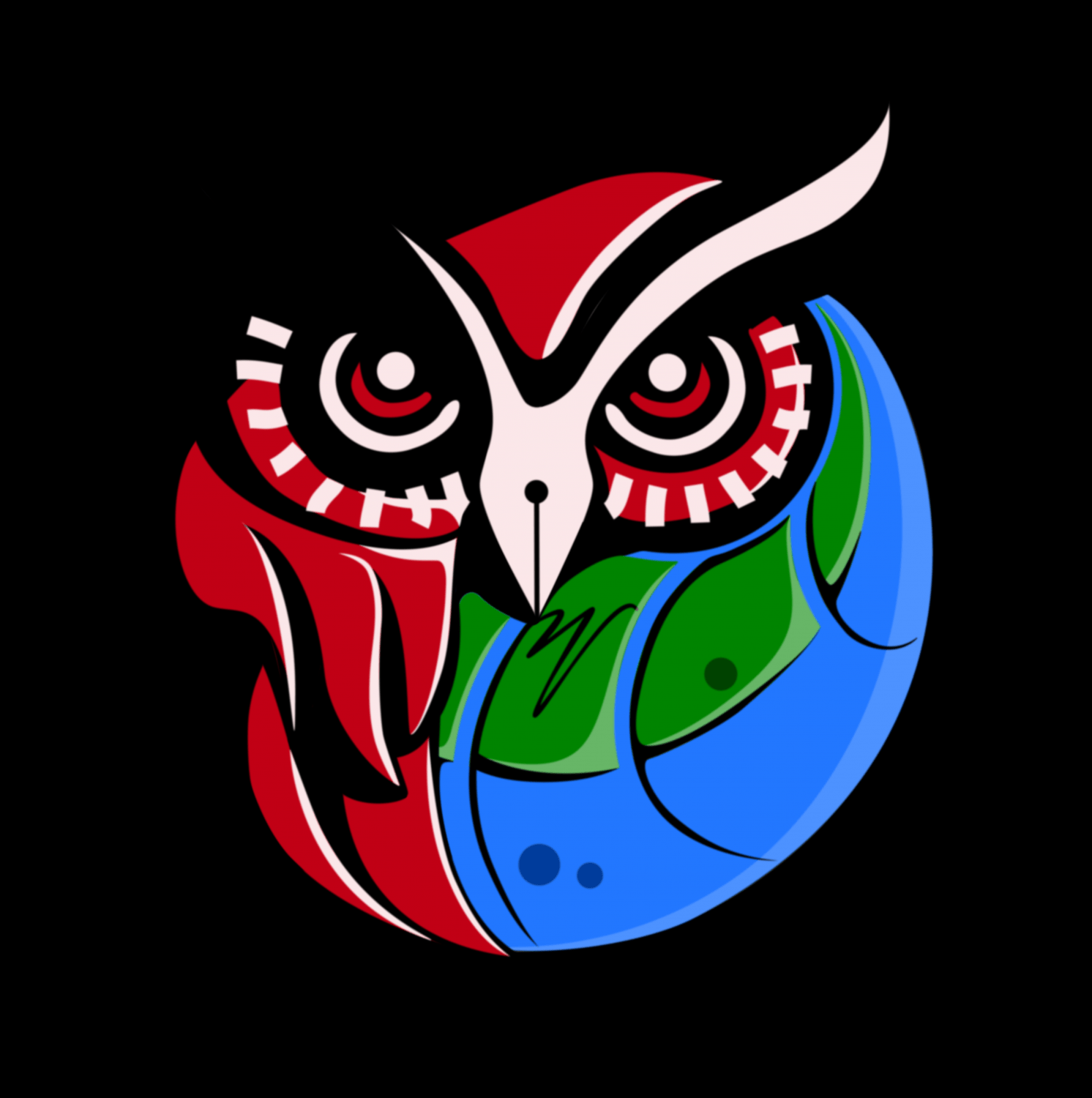

Schreibe einen Kommentar