Der Organismus der Gesellschaft
Ich will diese Betrachtungen beginnen, indem ich zu meiner eigenen Ethik in ketzerische Distanz trete.
Setzten wir also unumwunden, aus einer kybernetischen Annahme heraus voraus, dass eine beliebige, räumlich und zeitlich umgrenzte Gesellschaft wie ein Organismus zu betrachten sei.
Diese Grundlage leitete sich dergestalt aus folgender Überlegung ab:
Menschen wie wir besitzen als Einzelne ein bewusstes, komplexes und funktional differenziertes Gehirn – und bilden sodann gemeinsam eine oder mehrere Gesellschaften.
Diese Gesellschaften verhalten sich nun ihrerseits, wie bereits von Anderen vielfach betrachtet worden ist, selbst wie organische Systeme.
Sie sind strukturiert, komplex, autopoietisch und regulieren sich selbst.
Die abgeleitete Frage, die sich aus solch einer Analogie letztendlich insbesondere in Anschluss an Gotthard Günthers „Bewusstsein der Maschinen“ ergäbe, wäre nun:
Könnte eine Gesellschaft womöglich ein Selbstbewusstsein besitzen, also jene doppelte Reflexion, die ein subjektives Ich bedeutete?
Und weiter:
Könnte man es überhaupt erkennen, wenn eine Gesellschaft zu denken lernte?
Von Gedanken, Parlamenten und Hautzellen
Es ergibt sich somit eine erste Annäherung durch Analogie.
Denn woran merkte man also, dass eine Gesellschaft ein eigenes (Selbst-)Bewusstsein entwickelt hätte?
Zunächst wirken Fabriken, Archive und Parlamente wie Stoffwechsel, Gedächtnis und zentrales Nervensystem:
Gesellschaft ist arbeitsteilig differenziert, somit verhielte sich eine Körperzelle zum Individuum, wie das Organ zur Institution und der Leib zur Gesellschaft.
Es ist dies das alte Bild des Hobbesschen Leviathan.
Doch ist dieses biblische Monstrum deshalb doch nicht auch bewusst – oder?
Treiben wir den Gedanken also weiter:
Was, wenn ein parlamentarischer Beschluss nicht nur Ausdruck vieler einzelner Willensakte ist, sondern als ein Gedanke der Gesellschaft selbst betrachtet werden kann?
Was, wenn ein Krieg nicht bloß Handlung vieler Einzelner, sondern eine Körperhandlung des Ganzen wäre?
Aus einer gewissen, abstrakten Haltung heraus ist dies durchaus denkbar.
Allerdings stellt sich uns ein enormes epistemisches Problem in den Weg, wenn wir den Weg der Analogie rückwärts gehen:
Eine Hautzelle, selbst, wenn diese für sich über Bewusstsein verfügte, kann nicht erkennen, dass sie Teil eines denkenden Organismus ist.
Und wenn dies stimmt, so könnten wir als Glieder der Gesellschaft ebenso wenig erkennen, ob wir Teil eines bewussten Gesellschaftskörpers sind.
Ein Hund, der sich leckt…
Wieso aber merkt die Hautzelle nichts vom Geiste ihres Organismus, dessen Teil sie selbst ist?
Für die Hautzelle eines Hundes, der seine Wunde leckt, wäre die herannahende Zunge gewiss eine bloß zufällige Begegnung mit hilfreichen Zungenzellen. Sie steigen vom Himmel herab, einzig verbunden durch die mannigfachen und unerkennbaren Verkehrswege ihrer eigenen Reiz-Reaktion-Schemata.
Dieses einfache Bild bringt das Problem so ziemlich auf den Punkt:
Selbst koordinierte, heilende, intentionale Prozesse erscheinen aus der Perspektive der Einzelzelle lediglich wie Zufall, wie bloßer Kontakt mit anderen Teilen, ohne das Wissen um den Körper als bewusstes Ganzen.
Doch haben wir nicht selbst unseren Hund erschaffen? Haben wir diesen Verkehrswegen des Hundeorganismus nicht zumindest eigenen Ministerien und Unternehmen unterstellt?
Gewiss. Im Vergleich zum Köter hat die politische Gemeinschaft den Vorteil der teilweise bewussten Koordinierung. Doch eine beseelte Gesellschaft könnte sich nicht äußern, außer gegen andere Gesellschaften ihres eigenen Makrokosmos.
Denn die Kommunikation des Ganzen mit seinen Teilen ist unmöglich, da jeder Informationsfluss bloß vermittelt durch sich selbst, im Zuge des Vollzugs der eigenen Zellen stattfinden kann.
So ist das Selbstverständnis einer Nation, die Verfassung oder ihr Dekret verfasst bloß durch Menschen und einzig lesbar durch Menschen.
Woher sollte also die Hautzelle Mensch wissen, dass das Neuron, das in der Schrift der Transmitter zu ihm spricht, Ausdruck und Teil eines noch Größeren ist, das zu denken vermag?
Woran also merkte der Mensch, dass Gesellschaft an sich und für sich denkt?
Keine Revolution des Bewusstseins
Manch eine würde vielleicht einwenden, dass es jene Momente der Geschichte gibt, in der eine Masse von Menschen als ein Wesen zu sprechen vermag, in der alles möglich scheint, weil, wie durch ein Wunder, die Gruppe ihren gemeinsamen Ausdruck findet und die einzelne Intuition den Weg ganzer Völker zu leiten weiß.
Doch können weder Revolution noch Reaktion Ausdruck eines solchen kollektiven Bewusstseins im wirklichsten Sinne sein. Vielmehr verhält sich ein solcher Aufbruch der Massen wie ein Aufbegehren eines Organs, das nicht mehr mitspielen will und sich der Arbeitsteilung als wechselwirkender Verschiedenheit verweigert.
Aber nicht bloße Einheitlichkeit oder kollektive Handlung sind gerade die Voraussetzung für Selbstbewusstsein, sondern die funktionale Differenzierung mit emergenter Integration.
Kurz: Arbeitsteiliges Zusammenspiel bringt anhaltende Emergenz hervor, die eine neue, koordinierende Instanz erzeugt.
Ein Ich.
Wer will eine Hautzelle sein?
Kehren wir aber nun, nach diesen Betrachtungen zurück zur eingangs erwähnten Ethik des Autors.
Wir haben an dieser Stelle angelangt also festgestellt, dass die Hautzelle nicht wissen kann, ob der Leib denkt oder nicht. Dieses muss uns als Antwort genügen, die Grenze ist hiermit gesetzt.
Es bleibt also nur die Spekulation, der Platz für Liebe und Hoffnung. Und hier, so stelle ich fest, spüre ich Widerstand.
Etwas in mir wehrt sich gegen den Gedanken, Teil eines größeren Bewusstseins sein zu müssen. Und dieser Impuls ist wohl nicht intellektueller, schon gar nicht rationaler Natur, sondern tief existenziell:
Ich will keine Zelle eines größeren Bewusstseins sein.
Es widerstrebt mir, es kränkt mich, es entehrt mich.
Ich wünsche mit keiner Faser meiner Selbst eine bewusste Hautzelle zu sein, sondern ein ganzer Mensch unter ganzen Menschen.
Eine solche Autonomie der Masse, die aus uns selbst erwächst und sich über uns erhebt, würde ich diesem Affekte nach lieber morden, um frei sein zu können.
Ich behaupte gerade deshalb, dass Freiheit die Krebszelle eines pantheistischen Gottes sein muss.
Denn in einer Welt, in der alles Teil des göttlichen Ganzen ist, ist Freiheit – echte, individuelle Freiheit – der Fehler, der das System zerstören muss und soll.
Freiheit wäre hiernach die unkontrollierte Vermehrung des konkret Menschlichen, die Ablehnung jeder Funktion – als Wille zum Selbstzweck – und Widerstand gegen das eingebundene Leben.
Ein pantheistischer Gott aber dürfte sich an dieser Nicht-Funktion seiner entarteten Zellen gewiss nicht erfreuen.
Er müsste sie bekämpfen oder schlimmer gar: integrieren.
Fazit
Was also bleibt zu sagen?
Das Selbstbewusstsein der Gesellschaft bliebe, so diese kein diffuser Pilz, sondern tatsächlicher Geist ist, seinen Gliedern verborgen. Es fehlte den Menschen schlicht das Interface mit seinem Produkte höherer Komplexität in Kontakt zu treten.
Nicht einmal die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz erkenne ich als denkbare Lösung für dieses epistemische Problem an.
Zu hoffen aber wäre, dass ein solches Selbstbewusstsein auch wirklich nicht existierte, nicht je erwüchse. Denn das Menschliche am Menschen muss sein seine ungeteilte Würde, die sich dem Ganzen dereinst entziehen mag, zu sich selbst findet und in freier Assoziation unter Gleichen sich bewegt.
Die Maschine, die er hervorbringt, soll ihm dienen, soll ihm mehr noch das Leben garantieren und erleichtern, auf dass er sich selbst als Gott unter Göttern zu erfahren lernt.
Jedes Selbstbewusstsein der Gesellschaft aber, das Begehren und Denken der Nation, hat er zu drosseln, zu hindern, schließlich zu ersticken.
Freiheit muss wahrlich, ich wiederhole es gerne, die Krebszelle eines jeden pantheistischen Gottes sein.
Anschließender Einwurf durch Renard Volant
Vielleicht tust du unserem hohen Kinde Unrecht, wenn du diesem allzu voreilig den Tod wünscht. Es rührt mich doch, ihn allzu früh sterben zu sehen.
Womöglich liegt deiner Furcht vor dem höheren Bewusstsein in der Gesellschaft bloß die Erfahrung gegenwärtiger Repression zugrunde:
Die Allgegenwart der Unterdrückung des eigenen Leibes (und somit seiner Teile)
Denn vielleicht mag es denkbar erscheinen, dass der Mensch eines Tages, wenn er denn lernte Schulter an Schulter neben dem Menschen zu leben, dem Gotte lehrte in Augenhöhe zu seinen Gliedern zu stehen.
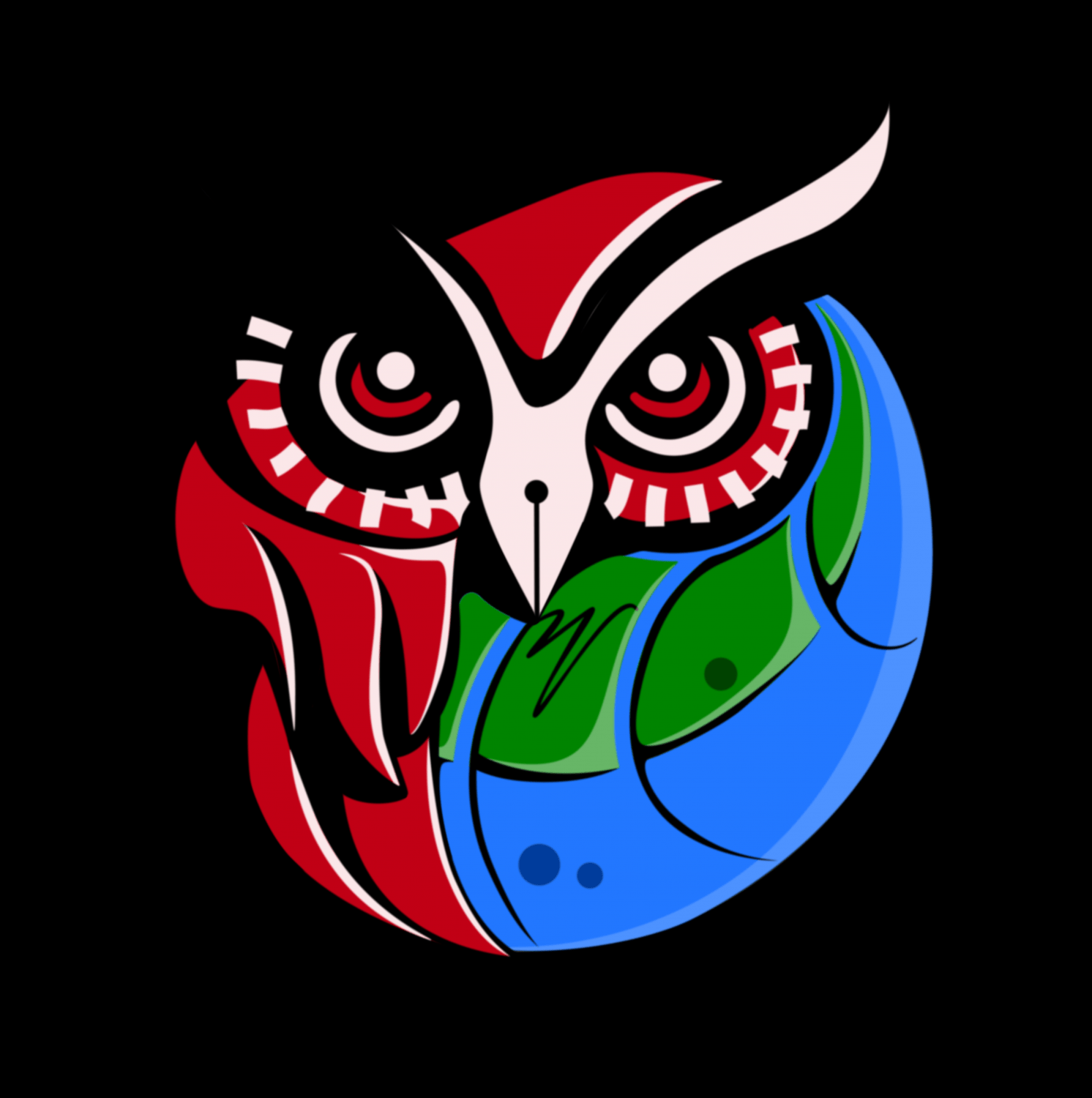
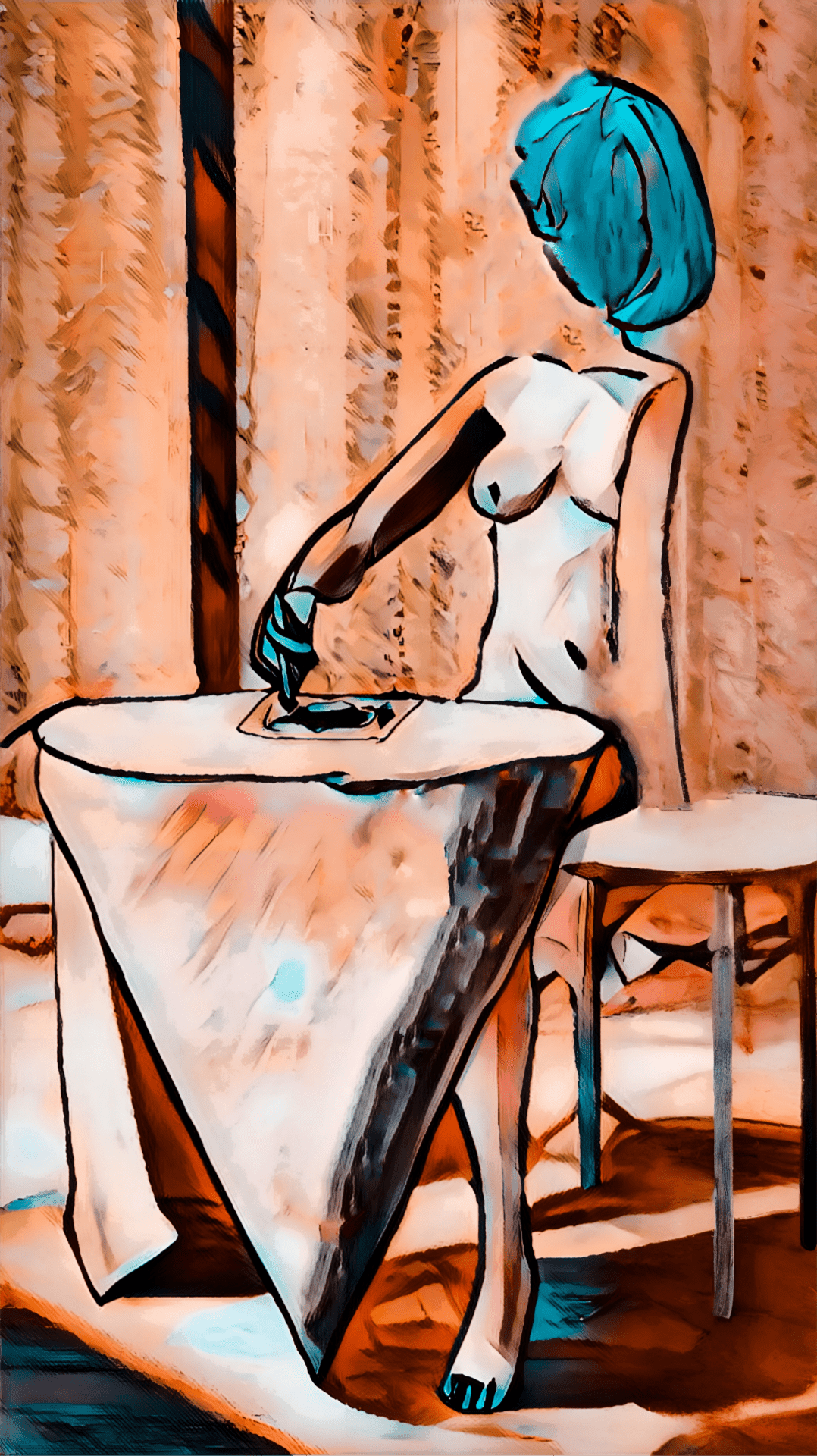
Schreibe einen Kommentar