Die Ursprünge der Gewalt
Adorno irrt, wenn er einzig dem Begriffe vorwerfe der Sache Gewalt anzutun.
Mehr noch, wenn er dieses alleine der bürgerlichen Gesellschaft zu Grunde lege, obschohn diese fürwahr ihr jeweiliges hinzufügen mag.
Doch entlarvt er bereits selbst die Ideologie des mythischen Zeitalters, die doch einzig aus der Vermittlung des Menschen mit der janusköpfigen Natur erwuchs.
Den Ursprung der Gewalt also stellte somit diese Natur – die Sache selbst.
Wenn nun also der Begriff sie zu beherrschen suchte, mag dieser trefflich irren und tatsächlich Freiheit gerade dadurch verunmöglichen, dass er Not und Notwendigkeit verdoppelte.
Und doch: In der Gewalt des Begriffs ist das Progressive genauso angelegt, wie die Barberei.
Der divergierende Begriff mag hierbei mitunter womöhlich jenes Nichtidentische darstellen, welches die Revolution bedürfe, indem er die hierfür notwendige Gegengewalt schaffte, um den repressiven Zusammenhang zu zerreißen.
Adorno wusste das, versäumte aber dieses zu betonen. Er sagte es, nahm es aber nicht ernst.
Wenngleich gewiss nicht unbegründet:
Denn der Zwang des neurotischen Denkens, welcher Natur verkennt, birgt Zerstörung.
Doch der befreite Traum vermag die Gesellschaft, wie die Entropie herauszufordern.
Jeder Fortschritt benötigt genau beides – wenn auch als Risiko.
Gerade aber den Traum lokalisierte Adorno im Nichtbegrifflichen, im zu Rettenden der Vernunft, die sich der Autonomie des Objekts bewusst ist.
Allerdings ist keine Kategorie, auch die formal logischste nicht, frei von Utopie – und sei es auch die der Widerspruchsfreiheit oder der unmittelbaren Erkenntnis.
Das Fortschrittliche der Wissenschaft letztlich, auch im Rationalismus und Empirismus, liegt also durchaus in ihrem Wahrheitsanspruch und den diesem zugrundeliegenden Mechanismen seiner Anfechtbarkeit als Falsifizierbarkeit.
Das Fortschrittliche negativer Dialektik hingegen liegt demgegenüber in ihrer spekulativen Hoffnung auf Erlösung – wider der erkennenden Vernunft durch die Vergöttlichung (im Sinne einer negativen Theologie) des Realen.
Göttliche Gewalt, wie Benjamin sie nannte, könnte also durchaus – muss aber nicht – auch im Begriffe liegen, wenn jener die Sache in der Praxis tatsächlich zum Besseren zu verändern vermag.
Im gleichen Maße jedoch, muss sich dieser bescheiden, wenn das Faktische ihn genorös zu belehren sucht oder ihn gar sprengte.
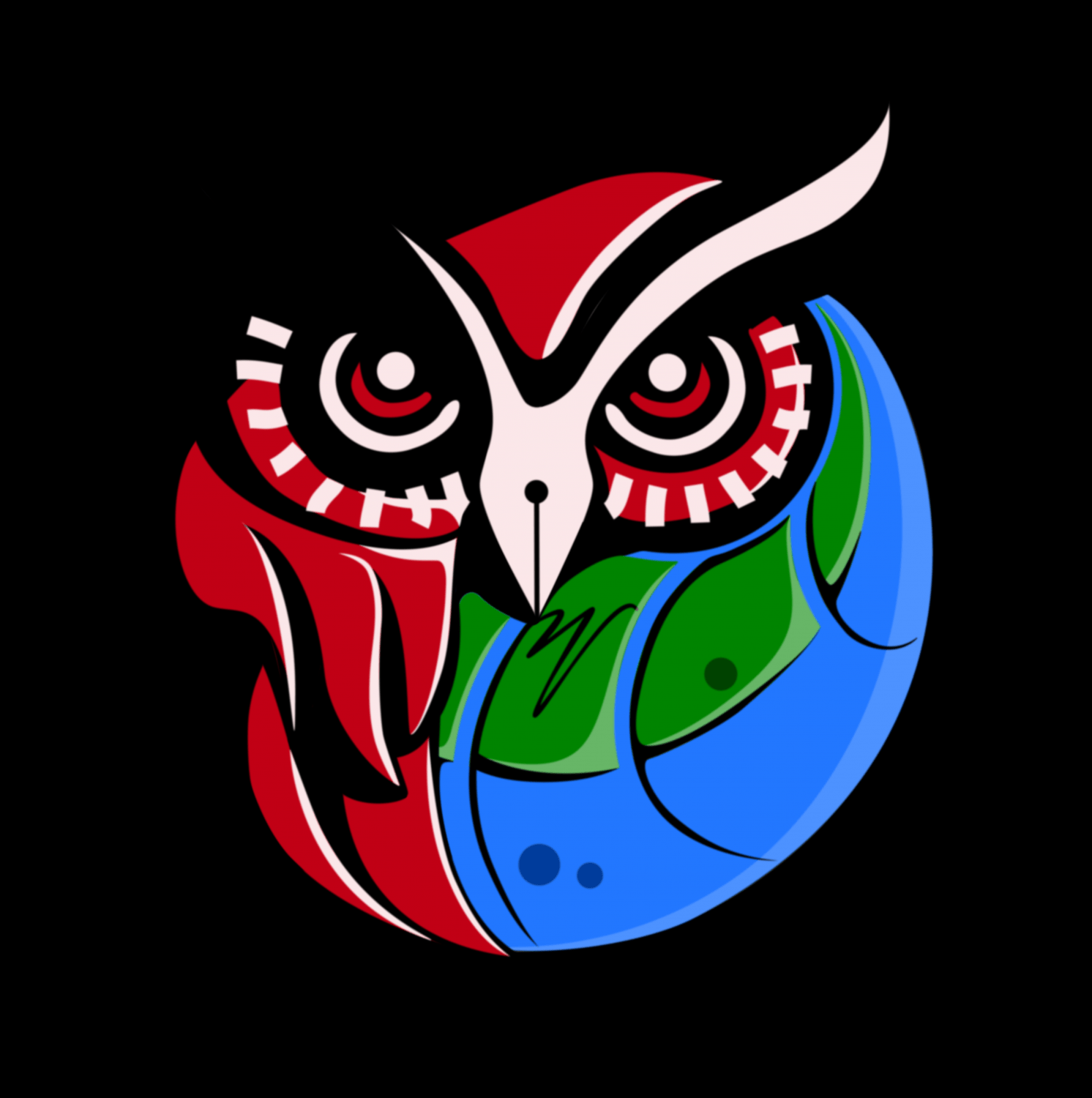
Schreibe einen Kommentar