Zum Verhältnis von Organisation und Bewegung:
Vieles ist bereits zum Staat geschrieben worden, gerade von sozialistischer Seite.
Allerdings gibt es dabei viele Unstimmigkeiten und Fehler in der Analyse.
Während die einen den Staat als feindlich ansehen und zerschlagen wollen (Leninismus / Anarchismus) halten die anderen ihn für einen neutralen Ort, der Gemeinwohlorientierung ermöglicht (deutsche Sozialdemokratie).
Während die einen ihn -zunächst- besetzen wollen (Leninismus / deutsche Sozialdemokratie) wollen die Anderen ihn direkt stürzen (Anarchismus).
Wie so vieles im Sozialismus, ist ‚der Staat‘ ein vortreffliches Thema um zu streiten und sich gegenseitig des Verrates zu bezichtigen.
Was aber ist der Staat?
Hierbei muss einiges vorweggesagt werden:
Ich nähere mich dem Phänomen Staat analytisch. D.h. Fragen der Empirie werden nur am Rande berührt, können aber problemlos im Anschluss thematisiert werden.
Die Frage nach dem Wesen des Staates lassen sich in drei große Teilfragen differenzieren:
1. Was ist der Staat im Kapitalismus?
2. Was ist der Staat im Sozialismus? (Wenn es ihn überhaupt geben soll)
3. Was ist zeitlich dazwischen, wie funktioniert also der Übergang?
Marxistisch betrachtet ist die erste Teilfrage nach dem Staat im Kapitalismus bereits gut geklärt. Ich referiere dabei nicht auf klassische Ansätze Lenins, Bernstein oder Bakunins (letzterer nur der Vollständigkeit, da selbst nicht marxistisch), sondern auf die sogenannte Ableitungsdebatte aufbauend auf Paschukanis.
Grob zusammengefasst:
Da sich im Kapitalismus die einzelnen Unternehmen und Einzelkapitale in Konkurrenz zueinander befinden, bedarf es, um die Konkurrenz auf Basis des Privateigentums zu erhalten, eines unparteiischen Dritten.
Der Staat fungiert hierbei aber nicht als Vertreter des Allgemeinwohls, der die gesamten Interessen der Bevölkerung vertritt, sondern als ideeller Gesamtkapitalist (Marx). Der Staat ist der Garant für Akkumulation, sprich Profit und Wachstum der Volkswirtschaft durch gleiche Regeln für alle.
Wertkritisch kann angemerkt werden, dass ohne sozialistische Alternative auch der Arbeiter selbst ein Interesse am eigenen Betrieb als Garant für Arbeit (d.h. Erwerb) haben muss, letztlich ändert das aber nichts an der Bewertung des Staates als kapitalfraktionsübergreifender Klassenapparat.
Durch die Aufrechterhaltung des Eigentumsverhältnisses sichert der bürgerliche Staat die Herrschaft des Kapitals über seine Staatsbürger ab.
Ob und inwiefern diese Ableitung zwingend ist, kann bezweifelt werden. Nicht zuletzt sind es gerade die realsozialistischen Staaten, aber auch diverse Oligarchien, die zeigen, dass Kapitalismus auch autoritär geführt, also mit einem offen parteiischen Staatsapparat funktionieren kann, vielleicht sogar höchst effizient sein mag.
Zunächst bleiben wir in der Betrachtung aber bei dem klassischen liberalen Bürgerstaat.
Nun, da die Frage des kapitalistischen Staates vorerst als geklärt gelten kann, bleibt die Frage des Staates im Sozialismus.
Und hier ist der Knackpunkt bei den meisten staatskritischen Ansätzen:
Ohne Privateigentum hat der Staat wie oben beschrieben seinen wesentlichen Charakter verloren und wird daher nicht von derselben Kritik getroffen.
Es ist also denkbar, dass dieser sozialistische Staat (wenn wir die neue institutionelle Ordnung so nennen wollen) nun tatsächlich als öffentliche Institution als Repräsentant des Allgemeinwohls auftritt.
Um dies zu gewährleisten müssen allerdings einige Mindestanforderungen gegeben sein:
1. Der Staat darf nicht selbst kapitalistisch abhängig vom Weltmarkt sein, also dem Wertgesetz entsprechend verpflichtet sein. Um sozialistisch zu sein muss ein Staat also a) groß genug, b) mit hoch entwickelten Produktivkräften und c) arbeitsteilig organisiert sein.
2. Um nicht selbst eine neue Bürokratenklasse zu bilden und somit zur neuen Klassenherrschaft zu tendieren, bedarf es demokratischer Basiselemente, wie Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Neben Parlament, lassen sich auch Formen einer Räteorganisation denken, vielleicht sogar nebeneinander.
Mit Karl Korsch argumentiere ich, dass sowohl eine Rätestruktur von unten, als auch eine staatliche Struktur von oben notwendig sein muss, da dem Partikularinteresse des Arbeiters in den Räten ein sozialpolitisch agierendes Korrektiv in der Regierung entgegenstehen muss.
Auch wenn mir linkskommunistische und anarchistische Konzepte der Staatenlosigkeit im Grunde genommen sehr sympathisch erscheinen, so glaube ich (wenn ich an dieser Stelle doch einmal empirisch werden kann), dass Gewaltenteilung, demokratisiertes aber zentralisiertes Militär (im Idealfall mit Soldatenräten im Sinne eines Korrektivs) und Rechtsstaatlichkeit ein probates Mittel gegen Willkür von oben und außerhalb sein können (von außerhalb, solange es sich nicht um den endgültigen Sieg des Welt-raum-kommunismus handelt).
Des Weiteren glaube ich, dass die Möglichkeit einer demokratischen Steuerung der Gesellschaft durch zentrale Institutionen notwendig bleiben, um Koordination und Ausgleich zu ermöglichen.
Dies alles aber nur, wenn – und das betone ich gerne einmal zu viel – diese Institution demokratisch kontrolliert sind.
Ein guter Sozialismus muss demnach sowohl zentralistisch genug, wie auch bürgerlich-demokratisch sein (im Sinne des Citoyens bei Rousseau), um ausschließen zu können, dass sich Antworten auf ökonomische Fragen zufällig ergeben oder von oben diktiert werden.
Man stelle sich eine Gesellschaft vor, die sich in Planung über ihre Produktivkräfte befindet:
Soll a) mehr Arbeitszeit in die Produktion von Konsumgütern gesteckt werden?
Oder b) in Rationalisierung, um später mehr konsumieren und weniger arbeiten zu können?
Oder wollen wir c) gleich weniger arbeiten und halt auf das ein oder andere verzichten?
Während im Kapitalismus die Frage ganz automatisch immer mit Option b) beantwortet wird (ohne dass wir jemals weniger arbeiten müssten), könnte man im Sozialismus tatsächlich politisch über diese Frage verhandeln.
Hinzu kommt natürlich die Möglichkeit auch über Verteilungsfragen entscheiden zu können, welche im Kapitalismus ebenfalls dem Marktmechanismus unterworfen sind, mit seinen eigenen, unveränderbaren Regeln.
Im Sozialismus, nach vorliegendem Modell, lässt sich aber hierüber streiten.
Man kann dann Algorithmen verwenden oder nicht, sie modifizieren, verbessern oder andere Mechanismen suchen.
Zuletzt kommen wir zur dritten und schwierigsten Teilfrage:
Wie kommen wir vom kapitalistischen Staat zum sozialistischen?
Diese Frage ist kaum zu beantworten, da die Funktion des bürgerlichen Staates der Funktion des sozialistischen Staates komplett gegensätzlich erscheint.
Es ist wahrscheinlich, dass eine einfache demokratische Übernahme des bürgerlichen Staates gänzlich versandet, da das Kapital sich nicht enteignen lassen wird. Geschichtlich lassen sich nur wenig Beispiele einer demokratischen Übernahme finden, die tatsächlich leider nicht sonderlich erfolgreich endeten (z.B. Chile). Eine militärische Sicherung erscheint somit notwendig.
Eine gewaltsame Übernahme mit dem Ziel der Sozialisierung hingegen birgt die enorme Gefahr, dass sich die neue Herrschaft festsetzt und sich demokratische Strukturen nicht mehr ergeben können oder aktiv bekämpft werden. Zu hoffen wäre in diesem Falle eine starke Bewegung, die ihre Führung nicht zu früh, aber auch nicht zu spät wieder zu Fall bringen kann. Historisch ist letzteres noch nie vorgekommen, dafür etliche Beispiele, in denen sich der Staat gegen die Bewegung verselbstständigt hat.
Ein kompletter Umsturz des Staates hingegen ist deswegen gefährlich, da in dem Getümmel der Revolution die falschen Strukturen schnell eine alternative und effiziente Verwaltung durchsetzen könnten und das gesamte Projekt im Fail State zum Faschismus gerierte (z.B. Der Bürgerkrieg in Spanien).
Zudem bleibt die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass sich der Staat so einfach entwaffnen lässt, ohne dass sich eine Gegenmacht bereits in den eigenen staatlichen Strukturen aufgebaut hat. Der antistaatliche Puritanismus scheint in dieser Perspektive nahezu aussichtslos zu sein.
Diese letzte Frage, so scheint es mir, ist die eigentliche, nicht im Voraus planbare Frage, die sich nur im geschichtlichen Verlauf der Bewegung, so sie denn noch einmal entstehen sollte, beantworten lässt.
Sie ist die Aufgabe aller Kommunist:innen.
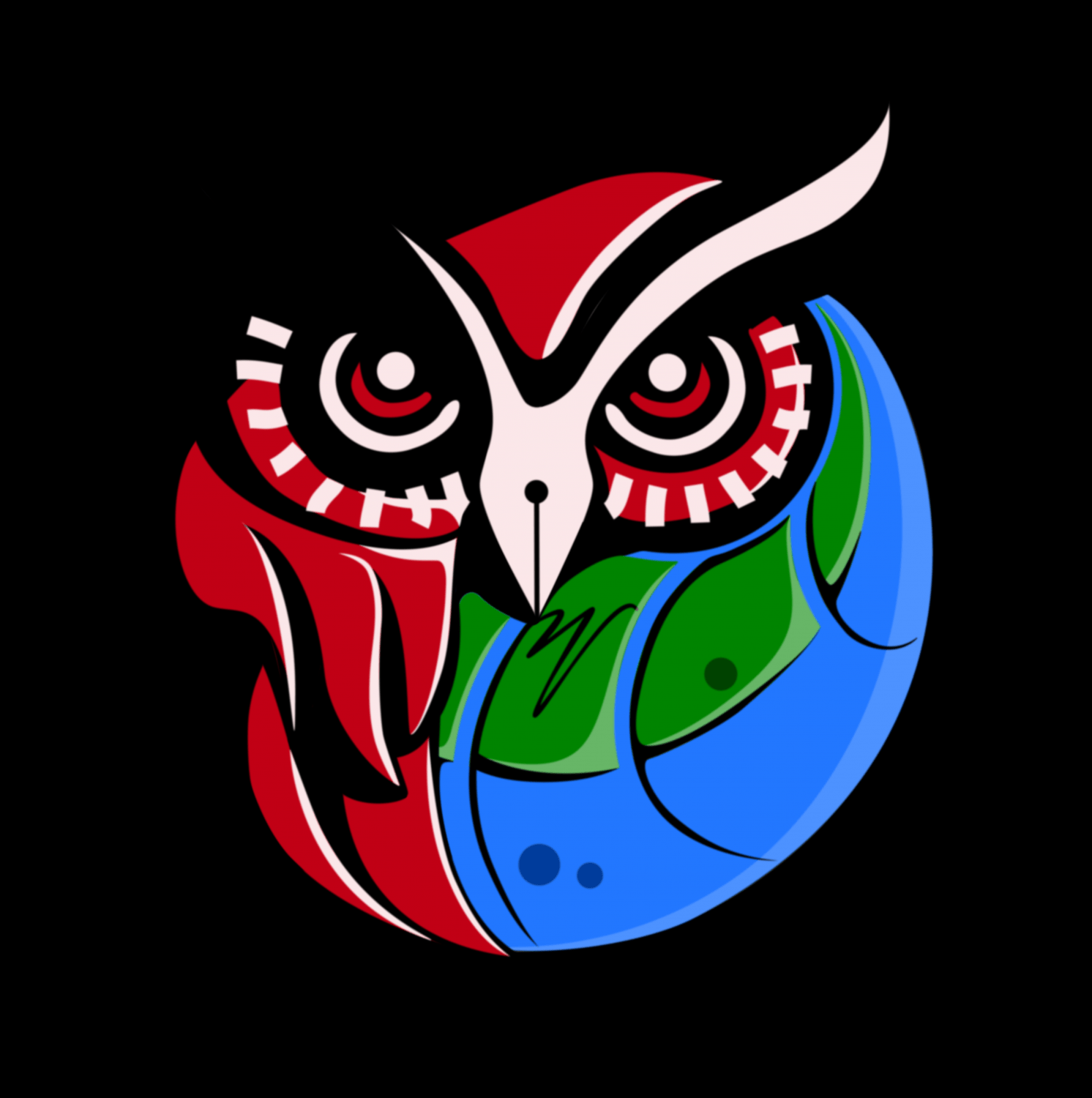

Schreibe einen Kommentar