1. Kapitalismus durchdringen – statt personalisieren
Die Linke muss verstehen: Die kapitalistische Produktionsweise ist weder eine Verschwörung der Eliten wider die kleinen Leuten, noch ein bloßes Klassenverhältnis im Sinne eines klar getrennten Zwei-Parteien-Kampfes der Vielen gegen die Reichen.
Die Marktwirtschaft auf Basis des Privateigentums bringt diese Dynamiken stattdessen selbst hervor, die automatisch zur Akkumulation von Geld, Macht und Zeit führen müssen.
Wir müssen verstehen, dass die materielle Herrschaft des Kapitals auch ohne personelle Kontinuität funktioniert – auch wenn die Profiteure sich seiner Sache nur zu gerne annehmen.
Der Kapitalismus ist also kein Fehlverhalten einzelner Akteure, keine moralische Entgleisung, keine Verschwörung von „Eliten“. Er ist ein System aus gesellschaftlichen Verhältnissen, das sich aus den benannten zentralen Prinzipien speist: Marktwirtschaft und Privateigentum an Produktionsmitteln.
Diese beiden Prinzipien erzeugen eine Welt, in der Produktion nicht dem Bedürfnis, sondern dem Tauschwert dient. Die Unternehmen handeln nicht, um zu versorgen, sondern um zu verwerten. Arbeit geschieht nicht zur Selbstverwirklichung, sondern als Zwang zur Lohnarbeit, um Zugang zu den Mitteln des Lebens zu erhalten. Das Ergebnis: Ein automatisches Subjekt (Marx), das sich durch uns hindurch fortsetzt – gleichgültig gegenüber Moral, Menschlichkeit und Vernunft.
Der Kapitalismus ist also nicht einfach ungerecht, sondern formiert unsere gesamte Lebensweise, unsere Beziehungen, unser Denken. Er ist tief in unseren Alltagspraktiken verankert: Kaufen, sparen, investieren, kalkulieren, konkurrieren – das ist nicht nur „wirtschaftliches Verhalten“, das ist unsere Sozialisation.
Wer glaubt, man könne dieses System „gerecht managen“, verkennt seinen Charakter. Die Krisen, die Ausbeutung, die Ungleichheit sind kein Betriebsunfall, sondern systemisch notwendig. Der Kapitalismus funktioniert genau dann, wenn er zerstört.
2. Der Staat ist zu kritisieren – ohne Staatenlosigkeit zu romantisieren
Die Linke hat zu erkennen: Der moderne Staat (so er im Weitesten Sinne liberal ist, also parlamentarisch verwaltet bei marktwirtschaftlicher Wirtschaftsordnung) ist zugleich Grundlage, wie auch in Abhängigkeit zum Kapitalverhältnis.
Er ist zu verteidigen oder zu erkämpfen, wo er politische Gleichheit schafft und individuelle Freiheit in der Lebensführung garantiert oder zu überwinden und aufzuheben, wo er durch Gesetze die private Wirtschaft (auch gewaltsam) absichert und das Eigentum an Produktionsmittel schützt.
Es ist in beiden Fällen zu berücksichtigen, dass die kapitalstaatliche Fähigkeit zur Wohlfahrt an die erfolgreiche Kapitalakkumulation, so sie weiter besteht, stets gekoppelt ist.
Der moderne Staat in diesem Sinne ist kein bloßes Machtinstrument, aber auch kein neutraler Garant des Gemeinwohls. Er ist eine dialektische Formation: Ergebnis historischer Kämpfe um Freiheit – und zugleich Form der Reproduktion des kapitalistischen Systems.
Die Gewaltenteilung, die positive Gesetzgebung, das allgemeine Wahlrecht, die Anerkennung individueller Grundrechte – all das sind reale Fortschritte. Sie markieren das Ende feudaler Willkür, die Verrechtlichung politischer Gewalt und die rechtliche Gleichstellung der Bürgerinnen als freie und gleiche Subjekte. Diese Errungenschaften dürfen nicht leichtfertig relativiert werden – sie sind Ausdruck vergangener Kämpfe um Emanzipation.
Doch diese Gleichheit ist bloß formal, noch nicht materiell. Der moderne Staat garantiert die Freiheit – aber nur in der Form, die der kapitalistischen Ordnung entspricht. Die freien und gleichen Subjekte sind zugleich Warenbesitzer, deren Beziehungen durch Eigentum, Konkurrenz und Abhängigkeit strukturiert sind. Der Staat schützt das Individuum – aber vor allem als Eigentümer, nicht als Mensch.
So wird die politische Gleichheit zur Rechtfertigung der sozialen Ungleichheit. Die Gewaltenteilung verhindert Machtkonzentration – aber nicht die ökonomische Diktatur der Kapitalakkumulation als Ordnungsprinzip. Die Menschen dürfen wählen – aber nicht, ob sie verkaufen oder verhungern.
Diese Ambivalenz führt zu einem Missverständnis: Viele Linke sehen den Staat als Instrument, das man „progressiv nutzen“ könne – und ignorieren dabei, dass der Staat selbst eine gesellschaftliche Form ist, die auf Trennung, Abstraktion und technokratische Verwaltung von beseelten Körpern basiert. Er ist nicht bloß der Schiedsrichter über ökonomische Kräfte, sondern deren institutionelle Verankerung.
Emanzipation muss daher beides leisten:
- Die bürgerlich-rechtlichen Fortschritte bewahren – denn sie sind Bedingungen der politischen Mündigkeit.
- Zugleich ihre strukturelle Begrenztheit überwinden – durch eine Form der Vergesellschaftung, in der Ausbeutung nicht mehr notwendig ist, weil Menschen ihre Beziehungen bewusst gestalten, nicht unter Zwang, sondern aus Kooperation.
3. Individualität und Gemeinwesen müssen verschwistert sein
Die Linke muss ihr Ziel definieren: Entgegen der kollektivistischen Tendenzen linker Bewegung kann Freiheit nur als solche bezeichnet werden, wo alle Menschen als individuelle Menschen frei sind. Zu lange hat sie sich hinter Kollektiven verschanzt – der „Arbeiterklasse“, dem „Volk“, der „Partei“, der „Bewegung“ –, ohne das zu benennen, wofür befreit werden soll: Jede Einzelne.
Freiheit kann nur dort existieren, wo jeder Mensch als einzelner Mensch frei ist. Ein System, in dem sich das Individuum für das Kollektiv aufopfern muss, ohne über seine Lebensumstände selbst zu bestimmen, ist kein Fortschritt – sondern nur eine andere Form von Knechtschaft. Ebenso wenig ist es Freiheit, wenn Einzelne sich über andere erheben, über sie verfügen oder ihnen die Bedingungen zum Leben verweigern – ob durch Armut, Ausschluss oder Abhängigkeit.
Freiheit verlangt Solidarität – aber nicht als Zwang zur Selbstverleugnung, sondern als gegenseitige Ermöglichung von Selbstbestimmung. Die Gesellschaft ist nicht der Feind des Individuums, sondern die Voraussetzung seiner Existenz. Arbeitsteilig, historisch, stofflich – ohne die anderen kann niemand leben, handeln, denken. Doch gerade deshalb darf Gesellschaft nicht zur Entschuldigung für Unterwerfung werden.
Der Maßstab der Emanzipation ist nicht das Wohl der Mehrheit, nicht die Stärke der Bewegung, nicht die Einheit der Klasse. Er ist das konkrete, empfindsame, verletzliche, denkende einzelne Leben. Wer Befreiung ernst meint, muss den Einzelnen zum Ziel erklären – nicht zum Mittel.
4. Identität ist keine Befreiung – sondern ihre Grenze
Die Linke muss Herzen gewinnen: So wichtig und richtig es ist, dass sich marginalisierte und unterdrückte Gruppen im Kampfe zusammentun, wo ihnen die Gleichheit verwehrt bleibt, so notwendig ist die Schaffung einer gemeinsamen Perspektive aller Individuen unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Sexualität, Religion, Alter, Gesundheit u.ä.
Während das freie Individuum historisch noch nicht geboren wurde, so ist doch die Verdoppelung der gesellschaftlichen Markierung durch linke Selbstmaskierung zu vermeiden.
Eine Frau mag als Frau diskriminiert werden, ein Schwarzer als Schwarzer unterdrückt. Doch nur als Menschen unterschiedlichster Erfahrungshorizonte und Perspektiven werden wir diesen Strukturen zuletzt entkommen.
Der Einzelnen darf nicht die Schuld des geteilten Systems auferlegt werden, auch dort nicht, wo sie den alten Mustern noch nicht zur Gänze entkommt.
Widerständiges und Konventionelles liegen jedem sozialen Wesen zugrunde. Und nicht immer ist das eine fortschrittlich und das andere rückständig.
Und auch das Recht Recht zu haben, steht prinzipiell allen Menschen offen, sogar dem weißen Mann (der davon jedoch seltener Gebrauch macht, als dieser vorgibt).
Die Linke muss also aufhören, sich mit der Reproduktion von Identität zu verwechseln. Identitätspolitik bedeutet ab einem bestimmtem Punkt im Kampfe keinen Fortschritt mehr, sondern verwandelt sich in eine defensive Anpassung an die Logik der Markierung, Verwaltung und Vereinzelung. Sie dreht sich dann um Sichtbarkeit, Zugehörigkeit und Authentizität – nicht um Befreiung.
Wo das Subjekt als Vertreter einer Gruppe spricht, nicht als streitendes Individuum, entsteht keine Solidarität, sondern ein Diskurs über Leidvergleiche. Die Gesellschaft verdoppelt sich hierdurch in ihren Schablonen – die Analyse verkürzt sich auf Perspektive.
Stattdessen braucht es eine antiidentitäre Linke, die nicht Unterschiede negiert, sondern sie politisch entmachtet. Nicht „Vielfalt“, sondern gemeinsame Feindschaft gegenüber Herrschaft.
Befreiung bedeutet auch: Nicht mehr definiert werden. Nicht mehr bekennen müssen. Nicht mehr sich selbst erklären. Nur wo das Individuum mehr ist als seine Zuschreibung, kann Gesellschaft mehr werden als ihre Klassifikationen.
5. (Gute) Völker gibt es nicht
Die Linke darf sich nicht verwirren: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist eine Phrase und nützt dem Regressiv-Nationalen. Das Menschenrecht ist dem Völkerrecht vorzuziehen. Mag es eines Tages jedem Menschen freistehen, sich dieser oder jener Gemeinschaft freiwillig anzuschließen – niemals darf dies mit der Aufgabe seiner Autonomie einhergehen. Keine Nation, keine Religion, keine „kulturelle Identität“ darf beanspruchen, Menschen innerlich zu binden oder äußerlich zu steuern. Tradition darf niemals Argument sein sondern allemal ein Grund zur Skepsis. Denn dort, wo Menschen durch Kollektive definiert werden, endet der Begriff der Freiheit.
Wenn wir überhaupt noch von Völkern sprechen, dann nur als historische Ungleichzeitigkeiten, als Spuren vergangener Gewalt und Gemeinschaft. Bestenfalls sind manche weniger schlimm als andere – aber ein gutes Volk gibt es nicht. Nur ein einziges Volk verdiente womöglich diesen Namen: das der befreiten Menschheit. Und selbst dieses wird nur dort real, wo es über sich hinausdenkt – zu einer offenen, noch ungedachten Vielheit von Bewusstseinsformen, menschlich wie nicht-menschlich.
6. Kein Schulterschluss mit autoritären Regimen
Die Linke darf sich nicht einspannen lassen: Eine gute Analyse des Imperialismus lässt eine einseitige Verurteilung des Westens (oder irgendeiner anderen, derzeitigen Weltallianz) nicht zu. Eine linke Analyse darf die Kritik an westlicher Hegemonie nicht zum Freibrief für regressive Allianzen machen.
Es bleibt wahr, dass der sogenannte Westen nicht nur Menschenrechte, Demokratie und Aufklärung im Schilde führt. Er trägt auch Profitzwang, Militarismus, Rassismus, ökologische Zerstörung in sich. Doch daraus folgt nicht, dass seine Gegenspieler – ob in Moskau, Peking, Teheran oder anderswo – heroisiert werden dürfen. Viele von ihnen vertreten keine Befreiung, sondern autokratische Herrschaft, theokratische Unterwerfung oder kultische Gewaltfantasien.
Es gibt hiernach Schlimmeres als den westlichen Kapitalismus. Wer das nicht sieht, macht sich blind für die Totalität des Unrechts, das auch jenseits westlicher Dominanz herrscht. Nicht jede Kritik am Westen ist fortschrittlich – und nicht jede Allianz gegen ihn ist legitim.
Eine erneuerte Linke muss eigenständig urteilen, ohne sich ideologisch einspannen zu lassen. Sie darf kein Sprachrohr konkurrierender Machtblöcke werden – weder im Namen des Antiimperialismus noch im Namen einer kulturellen Identitätspolitik, die Freiheit nur selektiv gelten lässt.
7. Frieden mit Israel – statt Freiheit für den Jihadismus
Die Linke muss sich hinterfragen: Die einseitige, verbohrte und jedes Maß übersteigende Abarbeitung mit dem Nahostkonflikt zugunsten der jihadistischen Sache muss aufhören. Die antisemitische Dimension des Antizionismus muss großflächig reflektiert werden und die Infantilisierung des Terrors als hilflosen Widerstand als Trugbild entlarvt. Wenn eine rechte Regierung in Israel jeden Tod innerhalb ihrer Bevölkerung zu Hunderten zu rächen sucht, so ist dies unmenschlich. Die Inszenierung des eigenen Opfers (als Reaktion auf die eigene Tat) im Bewusstsein dieser Folgen allerdings ist faschistischer Märtyrerkult.
Die Methode des propagandistisch ausgeschlachteten Selbstmords der palästinensischen Bevölkerung durch ihre Führerclique darf somit nicht länger ihren Widerhall im Diskurs der Emanzipation finden.
8. Krieg und Militär dialektisch begreifen – statt moralische Reflexe kultivieren
Die Linke darf sich nicht mehr rausnehmen: Zuletzt ergibt sich aus dem vorangegangenen auch eine strategische Neuausrichtung in Fragen des Krieges im Allgemeinen.
Auch hier bleibt zunächst richtig: Krieg ist schlimm. Es gibt keine Steigerungsform und keinen Euphemismus, der hieraus anderes ableiten könnte. Nicht einmal der Völkermord taugt zur Relativierung. Nichts desto trotz, ist die Vorgeschichte der Befreiung, in der wir uns befinden, kein befriedeter Ort.
Reaktionäre und brutale Gestalten tummeln sich in den Völkern und an ihrer Spitze. Und auch das Volk selbst, die unterdrückten, verarmten oder bloß abhängigen Einzelnen finden sich wieder in Zuständen, die keinen Frieden zulassen können. Und auch, wenn der Impuls zu leben, der Postheroismus einer hedonistischen Gesellschaft im Menschlichen seine Berechtigung findet, so mögen sich aus der Sorge um die Gleichen oder aus der eigenen Unfreiheit heraus doch Gründe ergeben, kriegerisch vorzugehen oder es zu müssen.
Da die Linke nun aber keine Armee hat (die wenigen sogenannten „sozialistischen“ Staaten mit ihrer Militärmacht einmal programmatisch ausgeschlossen) doch aber die Welt, wenn nicht das Gute, so doch zuweilen das Bessere kennt, so ist auch der konsequente Pazifismus oder die schematisch antiimperialistische Vorparteinahme abzulehnen.
Zwischen patriotischen Schlächtern und sanftmütigen Zynikern benötigen wir wieder Soldatenräte und Einfluss in die Sphäre des Militärs.
Das Ziel müsste sein, eine demokratisch verfasste, antifaschistische Interventionsarmee zu vollbringen, die sich auf die Seiten jener Menschen schlägt, die wahrhaftig auf der Seite des Fortschritts stehen.
Dabei darf die kritische Parteinahme, wie ausgeführt, nicht entlang geopolitischer Großschemata verlaufen: Wenn die Allianzen einer multipolaren Welt vermehrt flüchtig geraten und von pragmatischen Sicherheitsinteressen geleitet sind, müssen wir unsere eigenen Interessen kennen und erkennen lernen.
9. Die Linke muss eine neue, weltumspannende Perspektive gewinnen
Nur auf diese Weise ist unsere Zukunft zu retten.
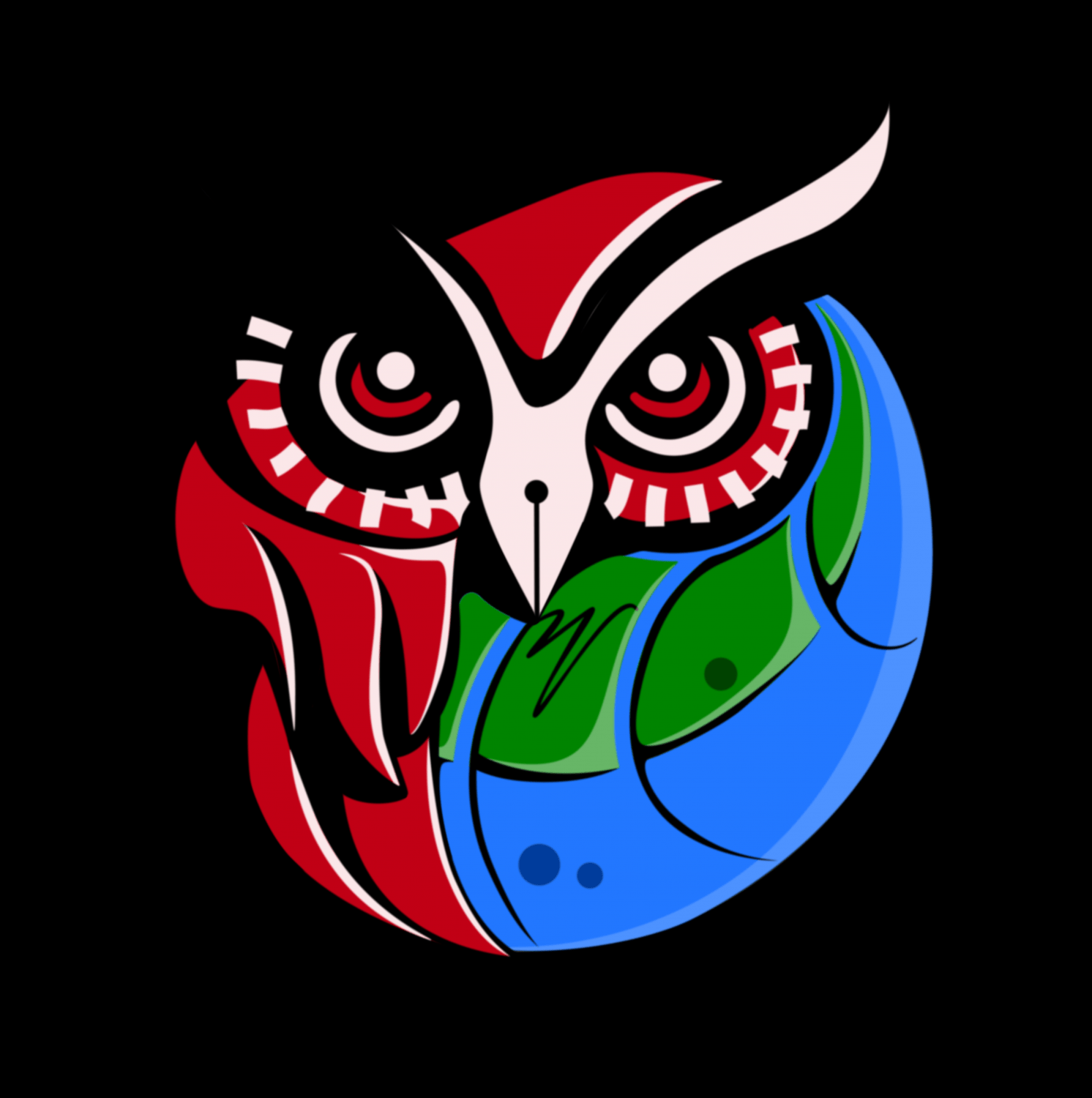

Schreibe einen Kommentar