Der Chauvinismus der Unsterblichkeit
Innerhalb von Tolkiens Welt herrschen kulturelle Unterschiede in der Wertschätzung des Lebens zwischen den Völkern Mittelerdes:
Je älter ein Leben sein kann, je näher es somit dem Zustande der Unsterblichkeit ist, desto weniger will es im Kriege geopfert sein – auch im universellen, manichäisch gezeichneten Kampfe Mittelerdes gegen Sauron und Mordor.
Denn während der Mensch dort beinahe für das Kämpfen und Fallen geboren scheint, so sind es die Elben, die sich geziemend des Schlachtfeldes enthalten, so sie nicht durch Ehre und Freundschaft ihr Herz erweichen.
Es erscheint uns plausibel, dass Geschöpfe, die Jahrtausende überdauern, eine größere Scheu vor dem Niedergang besitzen, als solche, die bloß Jahrzehnte verweilen.
Dabei ist es in der Realität, zumindest unter uns bewussten Wesen in den wohlhabenderen Gegenden der Erde, wo die Kindersterblichkeit keinen Alltag stellt, die Regel, dass gerade die Jugend, die geringe Jahreszahl also, am schwersten wiegt gegenüber jenen, die doch zumindest das Privileg innehaben, bereits ein Sammelsurium an Erfahrungen aufweisen zu können.
Der Unterschied in diesem Umstand ist jedoch folgender:
Des Menschen Potential zum Alter ist in ihrer Varianz überschaubar.
Es ist anzunehmen, dass unter Bedingungen, in denen von vornherein feststünde, dass das Sterbealter von jenen höher sein mag, als von diesen, jene eben auch eher geschont werden wollen als diese, um die bloße Möglichkeit des langen Lebens für sich zu beanspruchen.
Was prinzipiell länger leben kann, so stellen wir fest, wird also auch höher geschätzt.
Und tatsächlich, so besteht doch auch in irdischen Gefilden die weltkulturelle, unausgesprochene Übereinkunft darin, dass die Gemeinschaftsglieder prekärer Gesellschaften, in denen der Mensch ohnehin bereits eher zur Fliege degradiert scheint, auch als mehr bereitwillig zu opfern angesehen wird, für Krieg, Armut und Blutarbeit, als solche in den zivilisatorischen Zentren, den ökonomisch und politisch mächtigen Territorien.
Subjektiv ist dies durchaus nachvollziehbar:
Ein Elb, der Äonen noch zu lieben, lernen und gestalten vor sich zu haben glaubt, muss viel eher seine Vergänglichkeit vermeiden wollen, als ein niederer Dunländer, der nach verdorbener Ernte ohnehin dem Hungertod entgegensieht.
Zum Glücke der Revolution ist der Mensch nun aber tatsächlich keine rassisch unterteilte Gattung, die natürlicherweise unsterbliche Elben, jahrhundertealte Zwerge und lediglich jubeljahralte Menschen umfasste.
Das Potential zum Elben liegt auf Erden allen Menschen im gleichen, niedrigen Anteil zugrunde, zumindest nach biologischen Maßstäben.
Der Chauvinismus der Unsterblichkeit in Tolkiens Welt ist uns bloß ein sozialer Effekt, Ökonomie, Unsicherheit, Nationalismus und Ideologie – und somit viel eher zu überwinden, als die göttlich-natürliche Kluft zwischen Quendi und Adanath.
Und doch erscheint uns die Klassenfrage zu lösen zuweilen als eben jenes Einfache, das nach Bertolt Brecht doch so unvergleichlich schwierig zu machen scheint.
Und das ist es auch.
Doch kein Gott und kein höheres Wesen, kein Eru und kein Ainur mag den Menschen erlösen – nur er selbst.
Und es steht uns zu, in diesem Ringen auch die universelle Unsterblichkeit zu gewinnen.
So sehen wir uns alle dereinst, Seit an Seit, in Valinor.
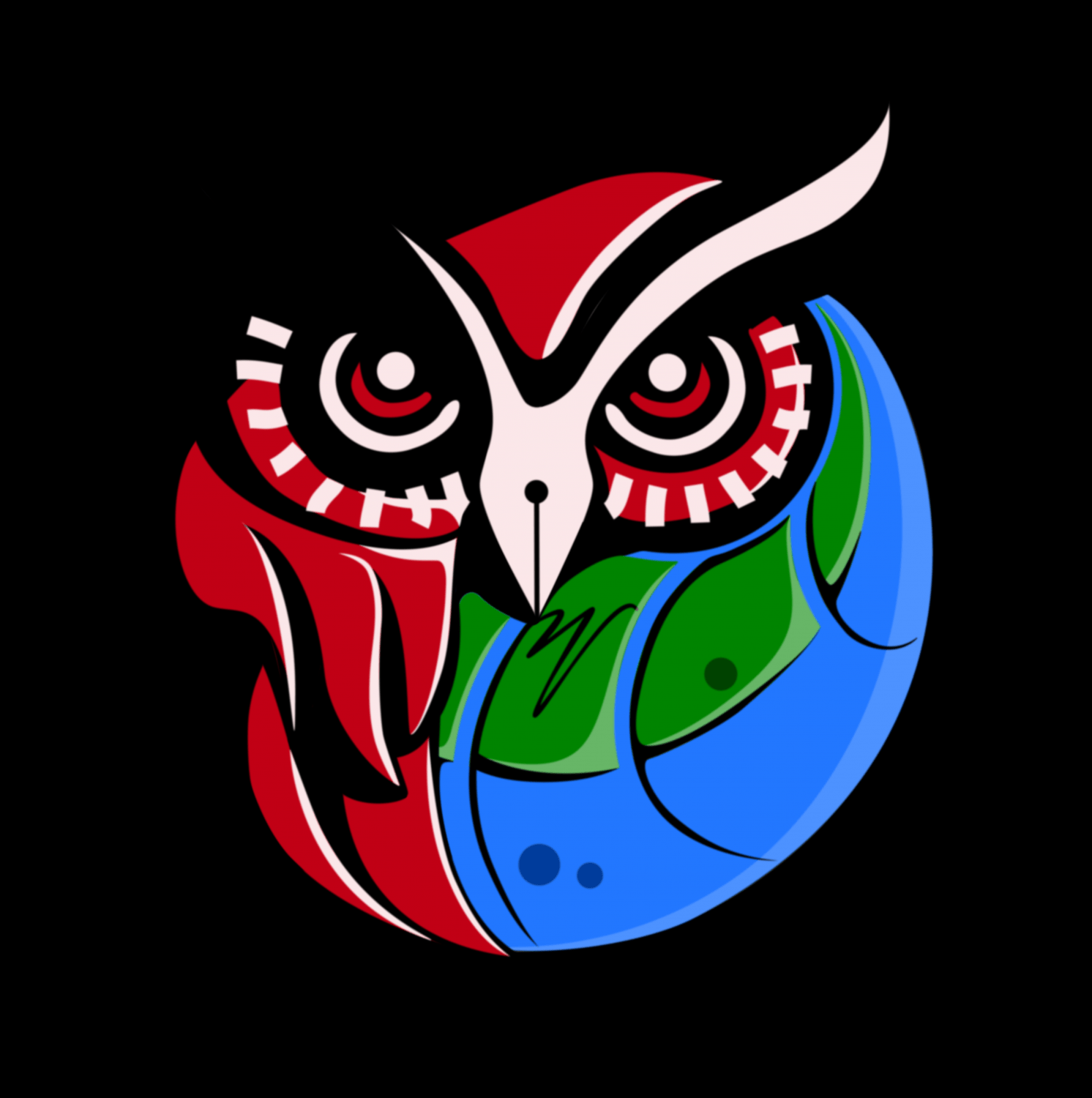

Schreibe einen Kommentar