Zum Dilemma des gegenwärtigen Feminismus
Seit geraumer Zeit erweckt sich mir der Eindruck, dass mich am gegenwärtigen Feminismus — dem ich gewiss nicht feindlich gegenüber stehe — etwas irritiert. Dieses Thema ist auch hier in der CM gewiss nicht neu.
Es handelt sich dabei aber wohl um etwas, das weniger aus dem Feminismus selbst resultiert, sondern aus der eigentümlichen Lage seines Gegners.
Das Patriarchat, wie es historisch existierte, wurde in vielen zentralen Fragen formal und juristisch erfolgreich und zum Wohle der Menschheit im Allgemeinen und der Frauen im Besonderen zurückgedrängt (zumindest im Westen): politische Ausschlüsse sind gefallen, Eigentums- und Familienrechte egalisiert, institutionelle Privilegien bröckeln. Doch der Abbau dieser Strukturen hat keine eindeutige Befreiung hinterlassen, sondern einen Zwischenzustand. Denn Machtverhältnisse verschwinden selten synchron mit ihren Institutionen; sie lösen sich zunächst materiell, dann symbolisch – und ihre Schatten überleben am längsten.
Was bleibt, ist eine verwilderte Form patriarchaler Logiken (Roswitha Scholz). Nicht mehr das geschlossene System früherer Jahrhunderte, sondern ein diffuses Bündel aus Symbolen, Erwartungshaltungen, Affekten, Archetypen herrschen vor. Das Kampffeld verlagert sich damit zwangsläufig auf die symbolisch-kulturelle Ebene, also dorthin, wo Muster nicht mehr fest sind, sondern beweglich, widersprüchlich, unberechenbar.
Genau in diesem flüssigen Raum muss sich heutige Kritik artikulieren — und flüssige Räume sind analytisch schwer zu greifen.
Daraus entsteht ein paradoxes Problem:
Je weniger klar umrissen der Gegner ist, desto stärker muss die Kritik ihn verfestigen.
Um aber patriarchale Reste und Mutationen dergestalt kritisieren zu können, muss der Feminismus zunächst Stabilität erzeugen — Begriffe fixieren, Kategorien abstecken, soziale Phänomene zu benennbaren Entitäten formen. Ohne diese Verdinglichung gäbe es keinen Angriffspunkt.
Doch die Realität ist oft längst weiter – ungleichzeitig, porös, hybrid. Das führt zwangsläufig zu einem, wie ich finde, nicht falschen Eindruck von Rigidiät, Schablonisierung und Einfallslosigkeit, nicht weil der Feminismus intellektuell verarmt wäre, sondern weil jede Kritik an einem verflüssigten Gegenstand dazu neigt, ihn künstlich zu verdichten. Die Realität, das Besondere, ist besser als ihr Begriff.
Und doch: Diese Problematik bedeutet keineswegs, dass das Patriarchat bloß noch als Symbol existierte.
Denn das alte Patriarchat ist keineswegs vollständig Geschichte, auch nicht im Inneren sogenannter liberaler Gesellschaften.
Es verlor zwar seine institutionellen Formen — mobilisiert aber seine Kräfte gerade darum mit neuer, aggressiver Energie. Die MAGA-Bewegung ist nur ein Beispiel hierfür.
Die Reaktion formiert sich aber nicht trotz des Fortschritts, sondern wegen ihm. In vielen Ländern und Milieus lässt sich beobachten, wie ein hartes, identitäres, häufig offen misogynes Gegenlager wächst: politisch, kulturell, digital.
Eine Art Rückschlagsphantasie, die sich nicht mehr auf alte Ordnungen stützen kann und gerade deshalb in extremen, puritanischen Bildern erscheint: der starke Mann, die Rückkehr zur Natur, die Wiedergeburt traditioneller Rollen und die Imagination von Gottes Willen.
Der Feminismus befindet sich damit nicht nur in einem Feld verflüssigter patriarchaler Schatten, wo er oft als ungerecht und grobschlächtig erscheint, sondern zugleich in einem Umfeld, in dem der alte Gegner mit neuem Furor zurückschlägt. Diese Reaktion verstärkt das Gefühl eines bleibenden Kampfes und lässt zuweilen sogar die Diffusion des Gegenstands verschwinden, weil der patriarchale Rückschlag wieder klare Konturen produziert, die jedoch nicht die Realität der meisten sozialen Beziehungen beschreiben, sondern eine ideologische Mobilisierung an dessen Polen.
Das verschärft die Lage doppelt:
Einerseits zwingt es feministische Kritik, härter und eindeutiger zu werden.
Andererseits verstärkt es den Eindruck, der Feminismus fixiere eine Welt, die längst im Übergang ist.
Wir leben somit in einer merkwürdigen Zwischenepoche mit Rückfallgefahr zwischen der Verwilderung des patriarchalen Systems und der Radikalisierung seiner Restbestände.
Das Feld ist somit widersprüchlich, ist weich und hart zugleich, porös und brutal, verflüssigt und doch beißend.
Vor diesem Hintergrund wird klar, warum der Feminismus mitunter zwei Gegner zugleich bekämpfen muss, dabei doch nur eine Sprache besitzt: auf der einen Seite steht der verflüssigte Schatten des Patriarchats und gegenüber seine reaktionäre Rekonzentration.
Dass seine Kritik dabei allzuoft starr, moralisch oder schablonenhaft wirkt, ist weniger ein Fehler als eine Folge dieser Lage. Doch genau hier bräuchte es Innovation und eine neue Fortschrittsperspektive, wenn mir der Managerjargon an dieser Stelle erlaubt sei.
Es bräuchte einen Feminismus, der die neue Fluidität versteht, nicht als Vervielfältigung von Identitäten, sondern als Individualisierung der Rollenverhältnisse, das Ticketdenken abstreift und in die vernebelte Zukunft blickt – ohne die Rückkehr des Alten zu unterschätzen.
Es bräuchte einen Zugang, der nicht nur Pathologien und Toxizitäten sucht und examiniert, sondern auch neue Formen der Subjektivität, Beziehungsdynamik und Freiheit ernst nimmt – unabhängig ihrer historischen Konnotationen.
Denn die Aufgabe besteht heute nicht darin, das Patriarchat künstlich am Leben zu halten, um es kritisieren zu können, sondern die wechselnden Formen seiner Schatten und seiner Gegenwehr zu analysieren — ohne dabei selbst unbeweglich zu werden.
Die Herausforderung liegt in der Fähigkeit zur Differenzierung, um zu erkennen, wann wir es mit Rauch zu tun haben und wann mit einem sich neu formierenden Feuer – und wo die Asche auch neues Leben gebiert.
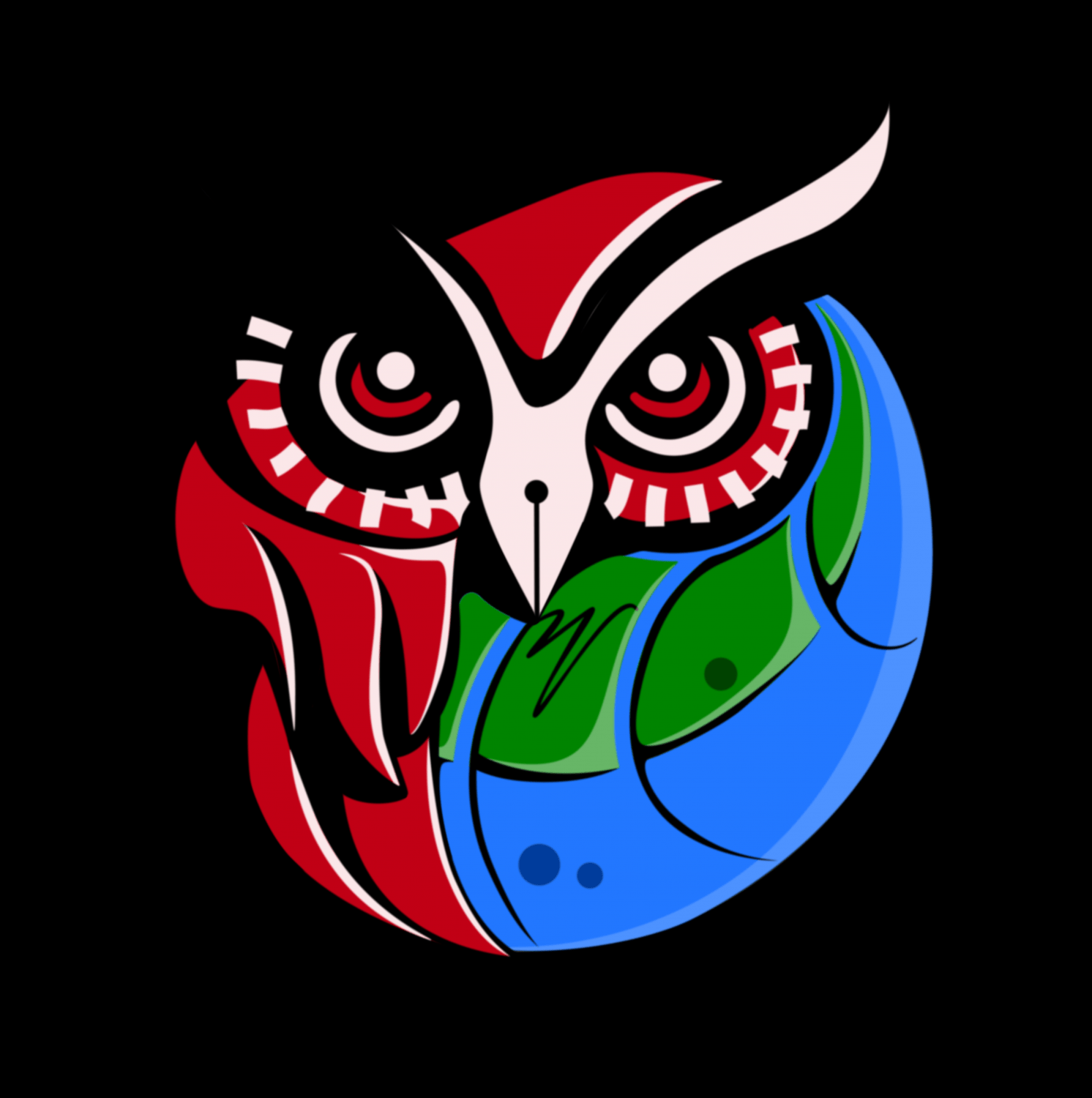
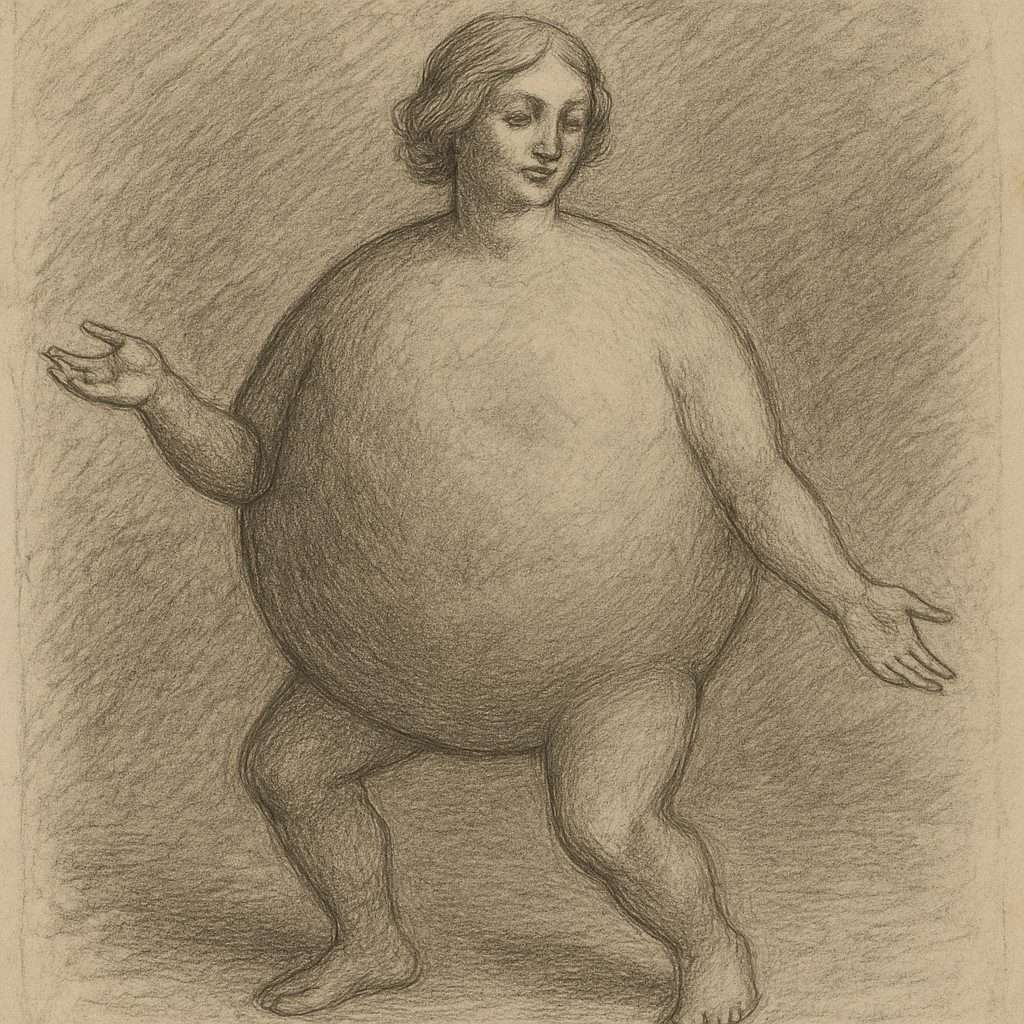
Schreibe einen Kommentar