Irgendwo zwischen artifizieller Arroganz und authentischer Ernsthaftigkeit dem Gegenstand gegenüber, liegt die Künstlerin. Denn diese nimmt sich vor, etwas Schönes zu schaffen, etwas, das sie selbst übersteigt, während sie zugleich gänzlich außen vorlassen muss, was man die Bedürfnisse des Publikums nennen mag, auch wenn dieses ein bloß vorgestelltes sei.
Kunst also, ist in diesem Sinne eine Tätigkeit, die sich entäußert, die derjenigen, die sie produziert, entfließt, nicht gedankenlos, doch in hohem Maße willkürlich. Dabei ist es in der Tat gänzlich irrelevant, ob es sich hierbei um das surreale Assoziieren handeln mag, wie Mark Erschüttert es zu bevorzugen neigt oder aber um das systematische Konstruieren von Albträumen und Beklemmungen, wie Renard Volant es beabsichtigt.
Doch Rücksichtslosigkeit liegt ihrem Wesen inne, ist nicht zahm, nicht harmlos, sondern selbstgerecht in ihrem Erscheinen, schert sich nicht um Reaktionen der Bedrückung, Verwirrung, Langeweile oder Erniedrigung.
Mitnichten ist deshalb aber Kunst ledig der Kritikwürdigkeit, im Gegenteil: Gerade aus dem Wegfall der Zensurschranke liegt der Kunst ihre Selbstkritik stetig inne. Denn im selben Maße, wie diese hinausweist, auf das, was unvollständig sein mag an dem Material, dessen sie sich bedient, so gerät dieses zwangsläufig auch in Konflikt mit seiner Übertreibung.
Kulturkritik ist dabei immer auch Kritik der Basis, aus der diese entsteht.
Zweierlei soll also durchaus nicht gesagt sein:
Zum Ersten ist der Stil, auch da wo er sich nonkonform geriert und versteht, nicht gerade deshalb von Wert, weil er – in irgendwelcher Art auch immer – rebellisch erscheint. Denn Kunst ist entgegen aller frequent wiederkehrenden Popularität des Punk doch auch Handwerk. Die Künstlerin also lernt stetig dazu, gerade dadurch, dass sie schafft, fährt fort in ihrer Entwicklung, wächst über sich hinaus, folgt einem verschütteten Ideal, das tief in ihr verborgen liegt.
Zum Zweiten ist die Unmoral der Kunst, wie wir sie definierten, nicht zu verwechseln mit der Freiheit gegen die Pflicht der Künstlerin, integer zu bleiben. Ein prominenter Sänger einer deutschsprachigen Rockband darf aus der Natur der Kunst heraus das Obszöne und Bösartige besingen, oh ja, nicht aber ausüben. Dass Kunst nicht mit der Künstlerin verwechselt werden darf, ist also eine zutreffende und notwendige Bedingung, doch ist dieses Verhältnis eine Forderung von beidseitiger Verpflichtung:
Die Künstlerin darf sich nicht verwechseln mit jener Figur, die sie zu schaffen droht, so sehr sich diese ihr auch annähern mag.
Wenn nun also der von uns vertretene Ästhetizismus mit der opulenten Selbstverständlichkeit eines Oscar Wilde die Unmoral in der Kunst völlig zu Recht als Kategorienfehler entlarvt, so liegt die Grenze jener Freiheit in der Intention, im Handeln, in der Tat der Künstlerin.
Und auch dort, wo Kunst instrumentalisiert wird, d.h. wo versucht wird ihre Fähigkeit von der Freiheit gegenüber der Tugend aus ihrer Sphäre hinaus in die gesellschaftliche Tätigkeit zu (über-)tragen, beginnt sie bereits politisch zu werden, beginnt sie ihren ästhetischen Selbstzweck zu verlieren.
Politische Kunst nun, wie wir sie durchaus auch – aber nicht nur – betreiben und betreiben wollen, muss somit auch gemessen werden an ihrem Zweck jenseits ihrer eigenen Gestalt. Die Künstlerin ist somit auch Politikerin im weitesten und limitiertesten Sinne.
Und doch: Auch das innere Ziel einer Künstlerin steht zurück hinter dem Eigenleben, das ein Kunstwerk, wenn es nicht schlecht gemacht ist, entwickeln mag. Denn politische Kunst, im Gegensatz zur Propaganda, muss ambivalent sein, darf nicht eindeutig sein, muss offen bleiben und darf sich nicht verschließen gegen das Unausgesprochene, gegen das Nichtidentische, das die reine Idee unterlaufen muss.
Zuletzt ist aber auch Kritik an der Kunst notwendig, wenn sie hohl bleibt, beliebig in Antizipation der Betrachterin, wenn sie sich anmaßt dem Gegenüber entgegenkommen zu wollen. Denn wahre Kunst ist niemals marktförmig, darf es nicht sein, wenn sie überleben will.
Nicht zuletzt auch deshalb ist der genannte Rockmusiker keine Künstlerin im emphatischen Sinne. Er ist Entertainer, Unternehmer, weil er den Kunden mitdenkt, profitiert vom Zugeständnis, sich bereichert an der Anbiederung, die Zielgruppe stets im Blick behält, während sich die Künstlerin mit all ihrem Mut zur Schöpfung in die Leere wirft.
Eine Künstlerin mag erfolgreich oder zumindest bewundert werden können, doch ein erfolgreicher Entertainer, auch beachtlich und respektabel im Fach, ist niemals Künstlerin.
Der Eine verliert sich, wenn er zur Anderen wird – und umgekehrt.
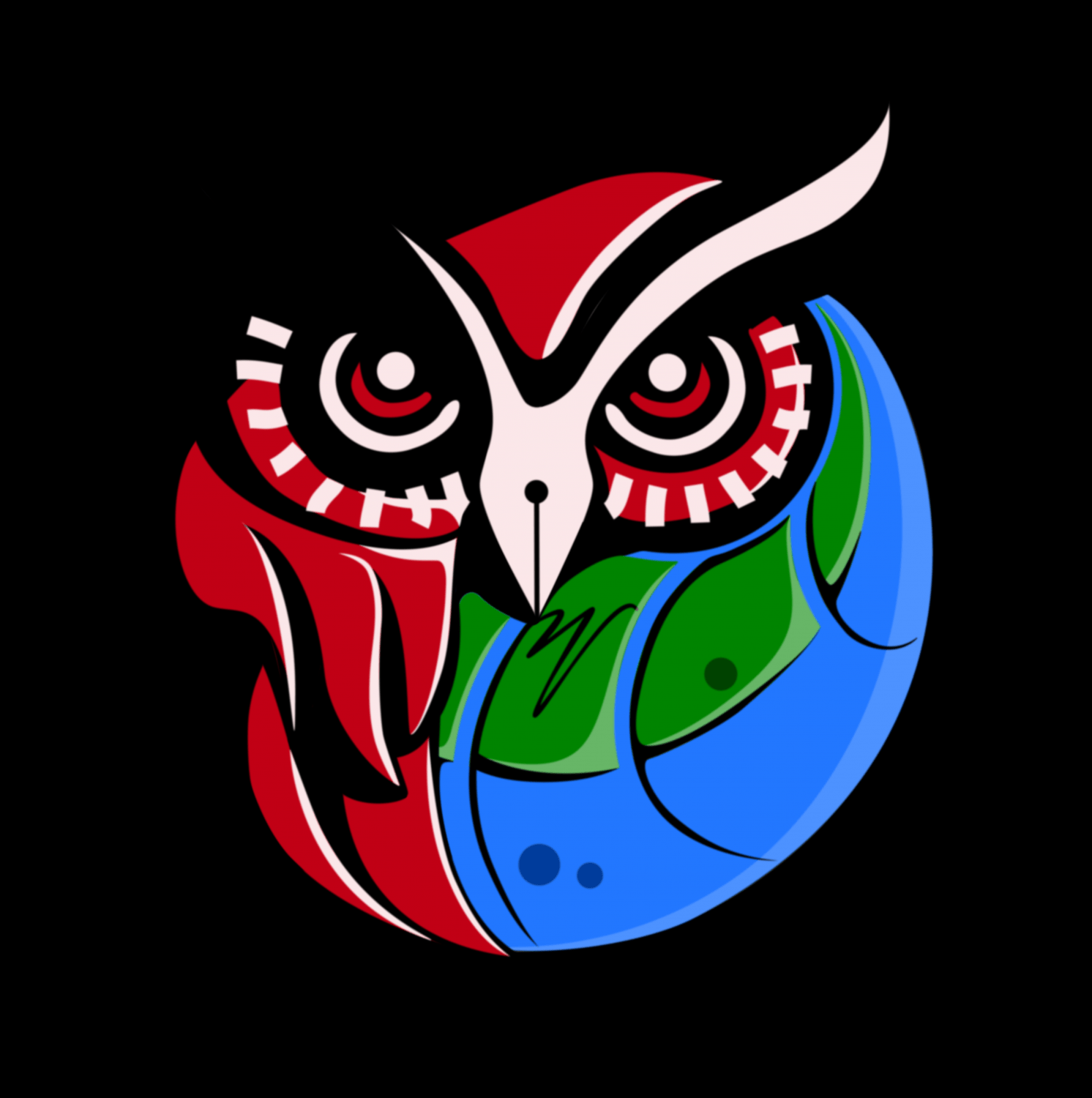
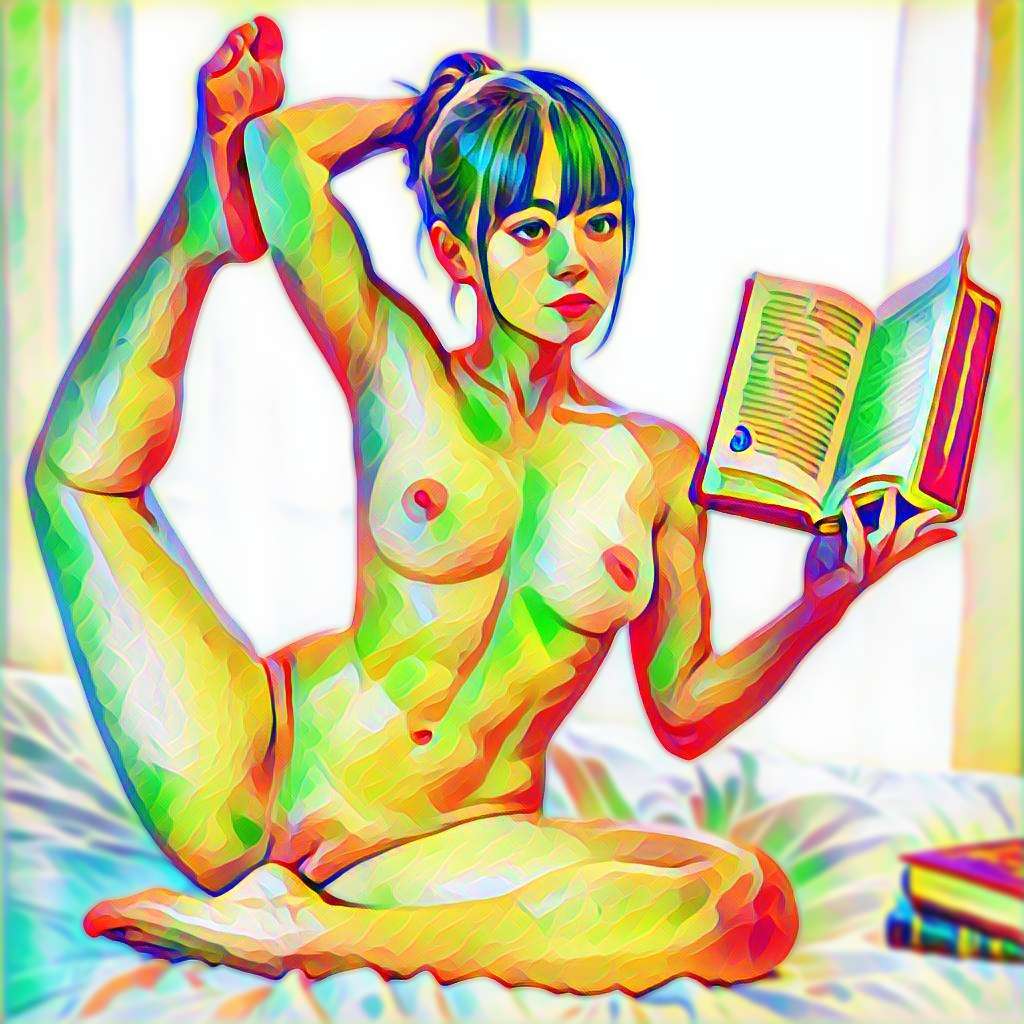
Schreibe einen Kommentar