Irgendwann, während meiner Schulzeit, erklärte mir ein Deutschlehrer, dass die direkte Rede in Erzählungen eher auf mangelndes literarisches Können verweise. Ein wahrer Schriftsteller dagegen nutze die indirekte Schreibweise.
Wie verbreitet diese Ansicht einmal war, weiß ich nicht, falsch ist sie ohnehin, so schafft es zum Beispiel gerade Franz Kafka nur durch seine brillanten Dia- und Monologe die frappante Kuriosität seiner Systeme zu erklären. Dieses auch und insbesondere, wenn diese so unnatürlich und unauthentisch wirken, wie keine anderen.
Doch entgegen dieser These meines Lehrers erscheint mir heute das schreibende Handwerk durch eine gegensätzliche Dogmatik entstellt zu werden:
Show, don’t tell.
Und sicherlich ist es durchaus ein Erfolg der Subtilität, wenn nicht ausgesprochen werden darf, worauf ein Text abzielt, jedoch scheint es mir, dass diese heiligste aller Regeln der Antizipation unterstellter Faulheit des Publikums entspringt.
Der Leser, so wird stillschweigend vorausgesetzt, muss sich identifizieren, um fühlen zu können, die Leserin muss Komplexität in mundgerechte Stücke zerteilt bekommen, um zu verstehen. Was Hierbei auf der Strecke bleibt ist die Kunst des Erklärens, die Poesie fiktionaler Sachlichkeit, die Innerlichkeit des Wortes und die Entwicklung eines Stils des Umfassens.
Nichts aber ist schädlicher im Schreiben, als Dogmatik.
Die Abwertung der direkten Rede ist womöglich ein Relikt älterer Erzähltraditionen, in denen „hohe“ Literatur sich eher an der Geschlossenheit der epischen Rede und an der kontrollierten Distanz orientierte.
Die Gegenbewegung – „Show, don’t tell“ sollte Autoren nun aber davor bewahren, ihre Figuren wie Pappkameraden durch lange, erklärende Exposition zu führen. Sie war ein Plädoyer für sinnliche Erfahrung, Konkretion, Handlungsbezug.
Doch irgendwann wurde daraus wohl ein moralischer Imperativ, als hätte Erzählen, Erklären oder gar Kommentieren etwas Beschämendes.
Im schlimmsten Fall führt das zu Texten, die zwar permanent „zeigen“, aber kein eigenständiges Denken mehr transportieren – die literarische Version von Kino-Storyboards.
Ignore them.
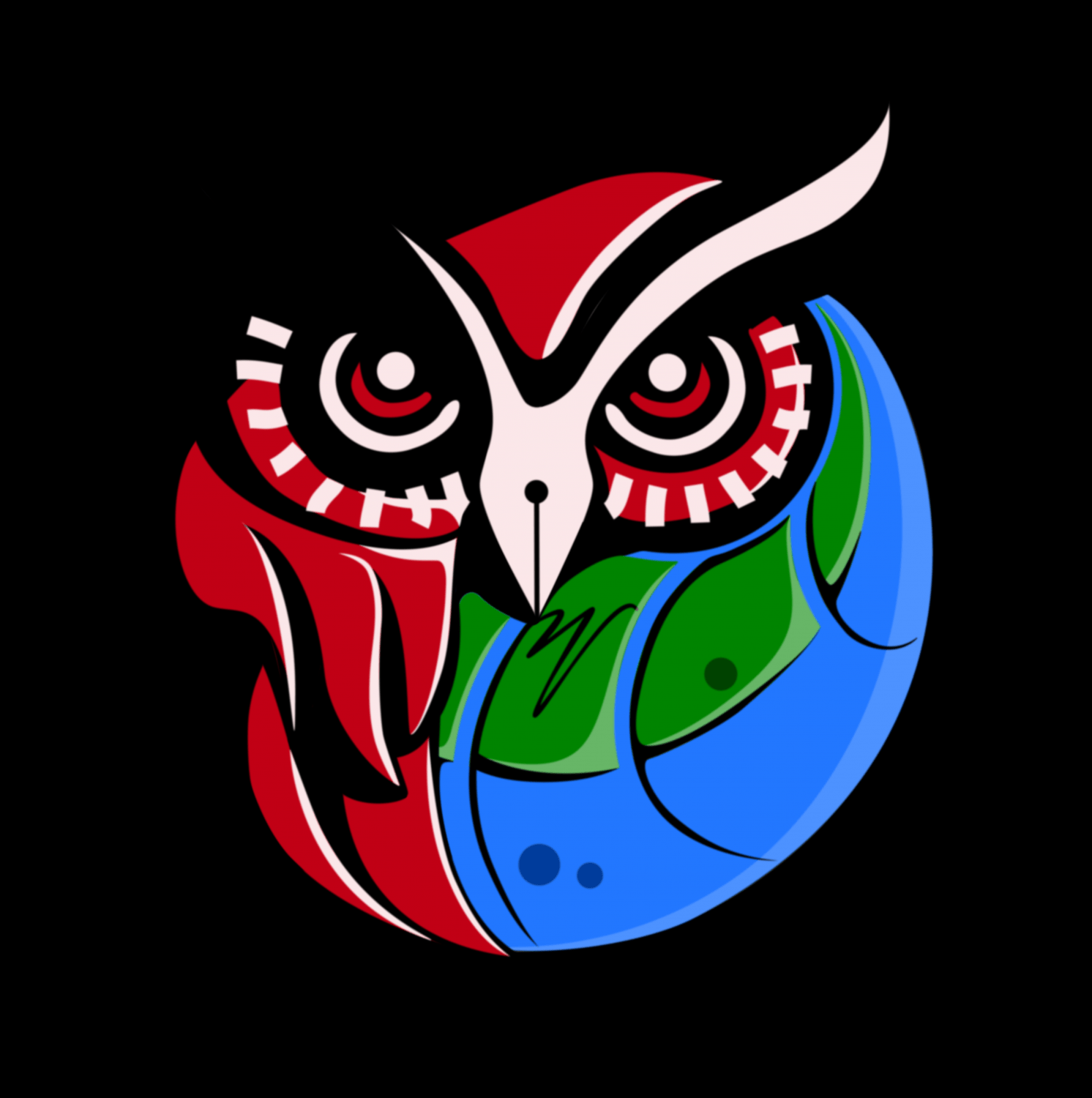
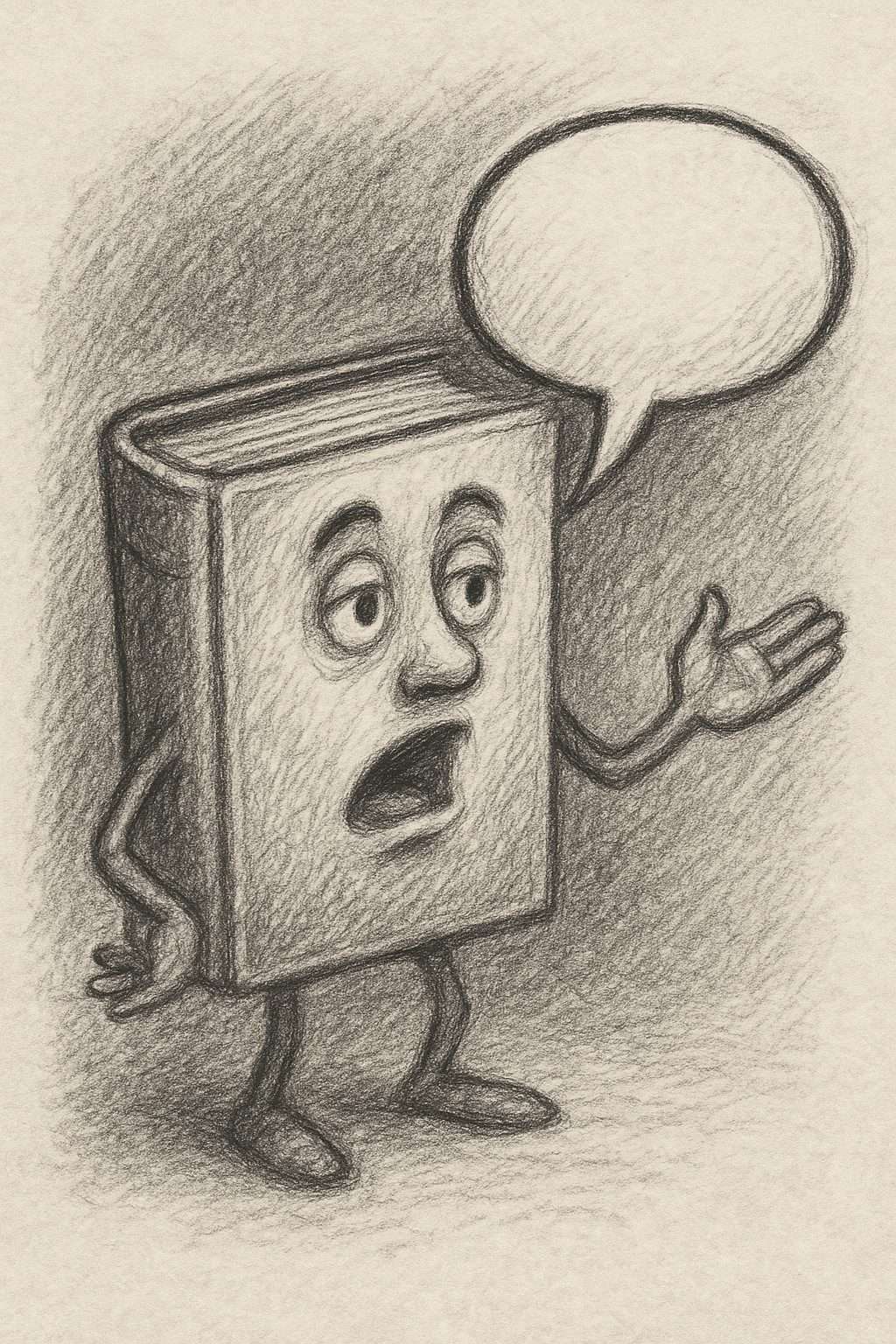
Schreibe einen Kommentar