Das Gute und das Göttliche Prinzip der Indifferenz
Die Realität in ihrer Geschichte steht dem Guten in seiner Totalität gänzlich indifferent gegenüber. Würde man unter diesen Umständen einen Gott denken können, der sich mit dem Prinzip des Guten vereinen ließe?
Nicht in seiner vollkommenen Größe, nicht als Panentität. Gott als Ordnungsprinzip kann nicht gut sein, das Gute nur existieren als übergöttlich im Wesen und zugleich unter diesem in seiner Ohnmacht gegenüber der Indifferenz.
Das Gute und Gott stellen sich so dar als unterschiedlich, als unversöhnliche Elemente eines Ganzen oder das Gute als bloßer Teil des Göttlichen, nicht als dieses selbst. Dies Gesagte aber machte Gott zu etwas Grauem – zu einem Grauen, das das Gute vielleicht kennt, voraussetzt, aber nicht bevorzugt.
Der Mensch selbst muss also wählen, nicht als Subjekt ohne Boden, sondern als Individuum, das das Subjektive sucht, im System zweiter Ordnung, verfallen im klebrigen Netz Gottes.
Erheben kann er sich nicht als Einzelner, nur im Ganzen, das dem Einzelnen dient, wenn es erscheint, wenn es dereinst erkämpft und organisiert wurde.
Es ist dies, oder es ist gar kein Gott, wie auch sonst kein Gutes. Dies ist die Erkenntnis einer konsequent durchdachten Deodizee.
Nihilismus oder Fortschritt unter Opfern.
Mehr bleibt uns nicht.
Die traurige Religion
Im Gegensatz zur nihilistischen „fröhlichen Wissenschaft“ Nietzsches, die noch aus dem Leid der Menschen selbst eine bloße Möglichkeit zur Freiheit im Sinne des Willens zur Macht ableitet, will ich darum, bloß aus meinem eigenen Gefühle heraus, eine traurige Religion begründen, die sich demgegenüber als allzu menschlich und empathisch darstellen soll.
Dieses Konzept nenne ich deswegen Religion, da es sich, im Gegensatz zum Begriffe der Wissenschaft, um ein metaphysisch-spekulatives handelt. Nicht aber leitet es einen Anspruch auf Dogmatik oder Anhängerschaft in Form einer Gemeinde her.
Traurig nenne ich es, da es tatsächlich, vom Grunde auf Ausdruck eben jenes existentiellen Affekts meinerseits ist, das nun nach Worten sucht, sich zu beschreiben.
Grundlage meiner Überlegungen ist ein zweifaches Problem:
Zunächst sei da die Annahme eines moralischen Universalismus, der als durchaus real vorausgesetzt und daher von mir unbedingt vertreten wird, ein zwar unerfüllter, aber wahrhaft gerechter Anspruch an die Natur und die Gesellschaft, dass der Mensch glücklich und frei sein sollte.
Demgegenüber steht jedoch die Einrichtung der Welt sowohl als eine Welt der Menschen, die sich gegenseitig in selbst geschmiedeten Fesseln halten, und eine Welt der Natur, die den Menschen zwar gebiert, doch stets wieder zu töten vermag und im Laufe des Lebens mindestens die Möglichkeit zur Qual darbietet, wenn nicht sogar exekutiert.
Hieraus folgt das zweite Problem, wie aus der Indifferenz zum Guten ersichtlich, wenn der moralische Universalismus als Objektives aufgefasst werden soll, sich aber vor der Wirklichkeit blamiert:
Die Theodizee eben dieses Universalismus.
Als ich mich einst vom Christentum ab- und dem Atheismus zuwandte, war vor Allem die klassische Theodizee des personalen Gottes hierfür ausschlaggebend: Ich erwog mich nicht mehr vor Gott fürchten zu wollen, der doch so viel Leid zumindest duldete, wenn nicht sogar hervorbrachte.
Ein allmächtiger Gott, so meine Erkenntnis, könne nicht allgütig sein, weshalb er im besten Falle willkürlich handelte, im schlechtesten aber böswillig.
Nun beschleicht sich mir mittlerweilen jedoch ein anderes Gefühl:
Ich empfinde Mitleid gegenüber eines Universums, das wie wir selbst, zum Sterben verurteilt ist. Und auch der unvollendet gebliebene moralische Universalismus findet sich in diesem Affekt wieder. Er will sich in die Wirklichkeit werfen, doch scheitert er am Laufe ihrer Geschichte.
So stellt sich mir Gott dar, in unpersönlicher Form, als etwas Deistisches oder Panentheistisches, dass das Leben durchaus bevorzugt, doch zu schwach ist es zu erhalten, wie er auch das Gute begehren mag, doch zu ohnmächtig ist, es auf Dauer hervorzubringen.
So ist meine Religion eine traurige geworden, wenngleich ich das Messianische ersehne, ja, sogar für möglich erachte, wenn auch nicht für wahrscheinlich.
Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder, in einem zu sich selbst gefundenen Universum, inmitten eines Gottes, der wir selbst geworden ist.
Das Paradies ist nicht, wenn nicht ein Kommendes.
Das Paradies ist nicht, wenn nicht ein irdisch Überirdisches.
Siehe auch:
Was ist negative Deologie?
Schon wieder Gott
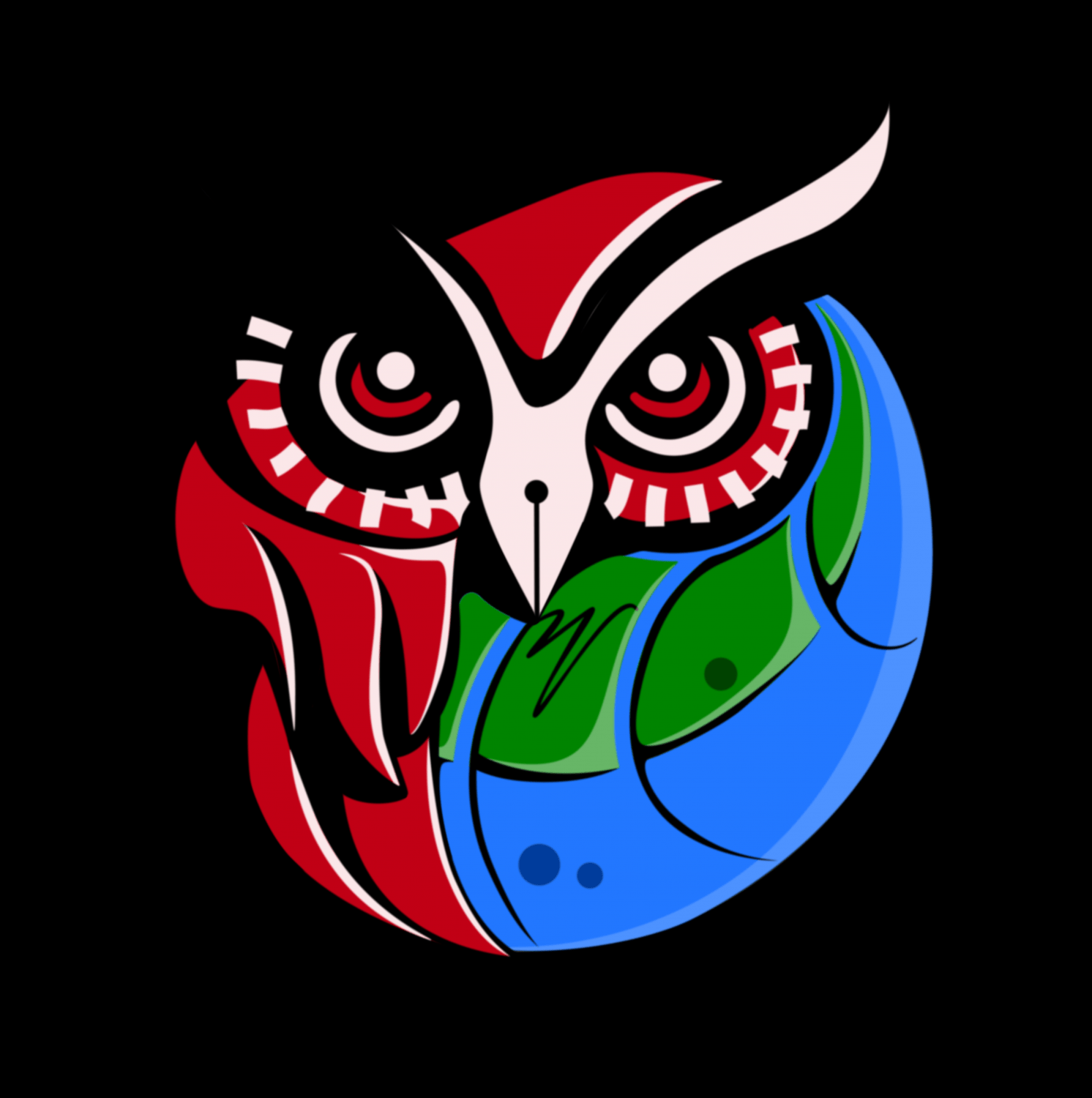

Schreibe einen Kommentar