Der Versuch einer Kritik ohne allzu tiefes Studium des Gegenstandes:
Nach Jahren der Enthaltsamkeit gegenüber allzu offensichtlich schlechter Literatur habe ich mich nun der Vollständigkeit halber daran gemacht die Twilight-Filme zu sehen.
Zwar hat es für die Bücher in der Tat nicht gereicht, aber ich möchte doch ein paar Gedanken zu dieser vor einigen Jahren doch recht populären Abstrusität unter den Vampirgeschichten loswerden.
Ich verzichte hierbei auf das allzu offensichtliche – hier am Anfang nur schnell erwähnt -, dass die Filme wirklich langweilig sind. Der Spannungsbogen existiert nicht, er schleicht auf niedrigem Niveau bis plötzlich gegen Ende so etwas wie ein epischer Kampf auf die Protagonisten hereinbricht. Zwischendrin glitzert es, herzschmerzt es, wiederholt sich der immergleiche Konflikt mit teilweise den immergleichen Dialogen (liebt er mich oder liebt er mich nicht; Edward oder Jacob; Vampir werden oder nicht, etc.).
An keiner Stelle allerdings werden diese Fragen ernsthaft verhandelt: Es steht zumindest für den Zuschauer nie außer Frage, dass Edward Bella liebt, dass Jacob keine wirkliche Chance hat Nr. 1 zu werden, dass Bella irgendwann ein Vampir wird.
Die einzige Überraschung findet im aller letzten Teil statt, die sich selbst durch eine weitere Überraschung eines Deus ex Machina selbst wieder auslöscht. – Hierzu später mehr.
Ich will allerdings einige Vergleiche anstellen zu den großen Vorgängern dieser Filme, nämlich dem Klassikerroman Dracula und dem auch sehr guten Roman und Film Interview mit einem Vampir.
Außerdem soll untersucht werden, welche Rolle das Christentum, insbesondere das Mormonentum hier spielt.
1. Die Klassiker – Leiden des Vampirs
Mit dem unangetastet bekanntesten Vampirroman Dracula von Bram Stoker teilen die Filme die Grundmythologie des Vampirs in abgewandelter Form: Unsterblichkeit, Untotsein, Blut trinken, schwer zu töten und irgendwas mit Tageslicht. Soweit so üblich.
Spannend wird, wenn man hierbei die Rolle, die der Vampir einnimmt, und auch die Rolle des Christentums vergleicht.
Vampire bei Stephenie Meyer sind ähnlich wie bei Stoker eine Gefahr für den Menschen. Sie leben versteckt und überfallen aus dem Hinterhalt unschuldige Seelen. Hierbei sind vor Allem die ‚bösen‘ Vampire der Volturi im Vatikan (Achtung!) dem gräfischen Adligen, in Form und Grausamkeit angelehnt.
Diese verkörpern ihrerseits in Meyers Welt die alte Ordnung der Vampire, nach Außen bestialisch, aber versteckt, nach Innen als Legislative und Exekutive wirkend zugleich.
Die Protagonisten aber entsprechen dem Bild des transsilvanischen Teufels nicht. Sie sind in einer Art Großfamilie in einem kleinen Ort organisiert und trinken entgegen ihrem innersten Drängen kein Menschenblut.
Dieser Topos des Haderns mit dem tödlichen Trieb ist bei Dracula nur zu Beginn einer Verwandlung enthalten, wirklich prägend für das Vampirdasein wird dieser Gedanke in den Romanen von Anne Rice beginnend mit Interview mit einem Vampir.
Hier ist es der Vampir Louis, der entgegen seines herrischen Schöpfers Lestat zu Gewissensbissen neigt, wenn er tötet. Ein Konflikt der nicht aufgelöst werden kann, ihn doch noch selbst zum Mörder werden lässt und ihn letztlich zum Bruch mit seiner eigenen Art bewegt.
Ästhetische Anleihen unternehmen die Twilight-Filme auch hier, so erinnert Aro, der Herr unter den Volturi, durchaus an den Bösewicht Santiago aus dem Theater des Vampirs aus der Rice-Verfilmung.
Während das ganze Werk Rices immer wieder mit der Verworfenheit und Leiden am Trieb im Innenleben Louis‘ spielt, so spielt dies bei Meyer nur verbalisiert eine Rolle.
Zwar betont Edward immer wieder, wie sehr er sich zusammenreißen muss, wenn er mit Bella zusammen ist und ganz selten, zur Unterstreichung der Gefahr, verliert mal ein Familienmitglied die Kontrolle, doch unter den schützenden Armen des Patriarchen Carlisle passiert zum Glück nie etwas.
Die Familie Cullen, heiliger Bund des vegetarischen Vampirs, verliert als System nie die Kontrolle.
2. Der Klassiker und das Christentum
Während das Christentum im Original Dracula eine gewichtige Rolle spielt, so kommt dasselbe in den Filmen Twilight der Mormonin Meyer nicht vor. Zunächst verwunderlich, wo doch häufig über die Parallelen zwischen konservativem Wertesystem und Twilight-Saga berichtet wird. Tatsächlich ist dieses aber auch ohne namentliche Erwähnung offenkundig – dazu später mehr.
Zunächst zum Christentum in Dracula:
Hier spielt das Christentum eine herausragende Rolle als positives Gegenbild zur Gefahr des Vampirs. Jonathan Harker, ein guter anglikaler Christ, der kurz vor der Hochzeit mit seiner Verlobten Mina steht, stößt im katholischen (vormodernen und abergläubischen) Transsilvanien auf den Grafen Dracula, der alles daran setzt ihm und seiner Verlobten zuzusetzen, der versucht auf englischem Territorium Fuß zu fassen und danach strebt sich und seine Brut dort festzusetzen.
Er spiegelt hier das direkt gegensätzliche zur christlichen Tugend und wirkt als Verführer, als Einbrecher in den Bund der Ehe, als entmannender Frauenräuber, als Krankheitsbringer gegenüber der gesunden, christlichen Lebensart, als Verderber und Verrücktmacher.
Sogleich sich dieser Roman eindeutig auf die Seite des christlichen Helden stellt, spielt er doch auf diese Weise mit der Angst vor dem Trieb, dem Verlust der Seele des reinen Christenmenschen und ist darin bis zu seinem Tod sehr erfolgreich.
3. Das Christentum in Twilight
Wie steht es nun um die christliche Seele bei Meyer? Zu Beginn noch stellt sich der Vampir, wie bei Dracula und Interview mit einem Vampir als Verdammter dar. Edward selbst beschreibt es noch so, seine Seele, so meint er, sei verloren. Eine Idee, die Bella allerdings strikt zurückweist.
In einem Rückblick erzählt Edward beschämt von seinem inneren Wesen, wie er als frischer Neuvampir Mörder und Vergewaltiger verfolgte, um seinen Blutdurst an ihnen zu stillen. – Selbst als Böser taugt Edward nichts.
Die ganze Familie aber, und hier beginnt nun das ganze Christentum, hat sich der Enthaltsamkeit verschworen. Bekannt ist, dass bereits seit den ersten Vampirromanen – noch vor Dracula, als Beispiel sei Carmilla von Sheridan Le Fanu genannt – das Blut trinken eine höchst sexuelle Metapher darstellt.
So etwas aber tut die Familie Cullen nicht. Der blass-blonde Vater, der mehr einer statuesken Engelserscheinung gleicht, als einem Vampir, sorgt mit verständnisvoller Durchsetzungskraft für das Einhalten dieser einen Regel.
Um die ganze Geschichte zu unterstreichen: Als nach (auch für den Zuschauer) Stunden mühevollen Zuredens Bellas Edward sich erbarmt sie in einen Vampir zu verwandeln, sprich: sie zu beißen, verlangt er eine Hochzeit als Bedingung. Eine seltsame Doppelung, da er auf jede Metapher verzichtet, als er auch wortwörtlichen Sex auf nach der Hochzeit verschiebt. – Er sei ja altmodisch mit seinen 109 Jahren.
Irritierend mag dem Christenmenschen nun die Hin- und Hergerissenheit Bellas zwischen Edward und Jacob erscheinen, der ihr einmal versicherte, man könne doch mehr als bloß einen Menschen lieben. Dass die Mehrehe, selten auch die Vielmännerei, unter Mormonen durchaus erlaubt ist, beseitigt allerdings diese Verwirrung.
Wie sehr hier auch das christliche Geschlechterbild eine Rolle spielt kann ebenfalls schnell exemplifiziert werden: Die Frau wird stets umworben, die Männer streiten sich regelmäßig darum, wer sie besser beschützen könne und der 4. Film handelt tatsächlich ausschließlich vom Heiraten und Kinderkriegen – wenn auch mit Komplikationen.
Am Rande sei erwähnt, dass ein auffälliger Unterschied zu klassischen Vampirgeschichten darin besteht, dass bei Meyer neugeborene Vampire zwar manipulierbarer aber, konstitutiv stärker sind als alle alten Vampire jemals.
Hierin spiegelt sich vielleicht die Erfahrung christlicher Gemeinden mit Neophyten, missionierter Neuchristen, die mit erhöhtem Elan und gesteigerter Indoktrinierbarkeit sich in den Kampf gegen das Böse und unchristliche stürzen.
Entgegen des Verdammtentopos lässt sich hier bereits erahnen, dass sich hier eine andere Form der Auseinandersetzung des Vampirs mit dem Christentum anbahnt.
4. Katholizismus, die verlorenen Stämme Israels, Orthodoxe und Mormonen
Wie bereits kurz angedeutet, ist es auffällig, dass die mormonische Autorin die Alte Ordnung der Vampire in den Vatikan verlegt. Eine örtliche Nähe dieser Ordnung, die als das Böse schlechthin zu gelten scheint, zum Herzen des katholischen Christentums, lässt einen aufmerken.
Auffällig ist auch, dass in der ganzen Reihe, die Familie Cullen, die wir im vorangegangenen Teil bereits als quasichristliche Gemeinschaft charakterisiert haben, sich zwar in höchste Distanz zu den Volturi begibt, aber ihre Regeln respektiert und sie nicht herausfordert.
Besonders spannend (ideologiekritisch, nicht filmisch) ist hierbei der letzte Film: In dem epischen (naja) Kampf der Familie Cullen gegen die Volturi zeigt sich viel Christliches und Mormonisches.
Das Kind, als eine Art Jesuskind, nicht unmöglich geboren von einer Jungfrau, sondern gerade umgekehrt unmöglich geboren mithilfe eines Toten im Liebesspiel, tritt als Bindungsglied zwischen Menschen und Vampiren auf.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass die Vampire als Welt der Christenheit auftreten, so ist dieses Kind, wie Jesus einst Bindeglied zwischen jüdischem Gott und potentiellen Heidenchristen war, erneut das Bindeglied zwischen den auserwählten Christen (Vampiren) und den ungläubigen Anderen (Sterblichen).
Dass die Familie Cullen hier als Mormonen auftreten erkennt sich vor Allem am Vokabular: Wie die Zeugen des Buches Mormon, suchen auch sie Zeugen, um das Wesen dieses Kindes zu beweisen.
Die letzte Schlacht nun, die vom katholischen Christentum gegen die friedfertige Mormonenfamilie geführt wird – eben, weil sie diese letzte Wahrheit nicht anerkennt und sie fürchtet – wird unter großen Opfern von der Familie Cullen, im Bündnis mit den bis Dato verfeindeten Werwölfen (ein indigener Stamm, der als der im Buch Mormon berichtete verlorene Stamm Israels in Amerika identifiziert werden kann) gewonnen.
Zur Vollendung dieser untergründigen Erzählung erscheinen im Übrigen auch zwei russische Vampire deren Paläste, die sie als Herrscherclique im Zarenreich innehatten, von den Volturi vernichtet wurden.
Denkt man diese Idee zu Ende, kann es sich hier um orthodoxe Christen handeln, die von der russischen Revolution entmachtet wurden. U.U. paart sich hier Antikatholizismus mit Antikommunismus. Aber hierfür reichen die Hinwiese nicht aus.
Die gewonnene Schlacht nun, die die Überlegenheit des Mormonentums bezeugt, stellt sich nun zum Schluss doch nur als Vision heraus. Die Katastrophe, die zwar zum Sieg, aber u.a. auch zum Tod des Patriarchen führte, fand nicht statt.
Die Revolution der Mormonen gegen den Katholizismus bleibt symbolischer Natur, die neue Ordnung bleibt gestärkt unter der alten Ordnung bestehen.
Die Harmonie der Familie, die Seligkeit der Enthaltsamen aber, ist wiederhergestellt und der Kaiser erhält, was des Kaisers ist: Die Volturi bleiben die Macht in Rom, der Familienclan erhält das Christuskind.
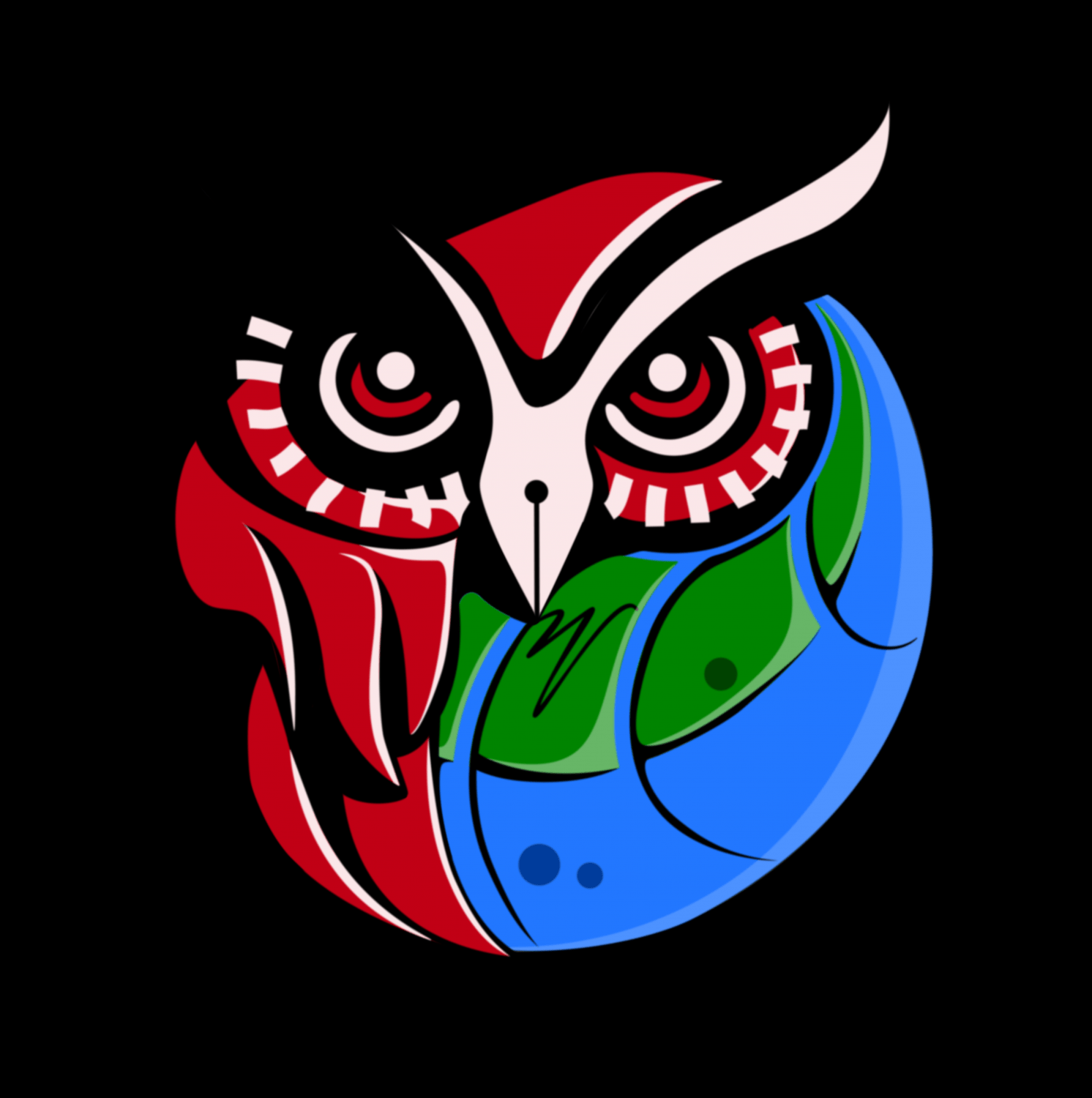
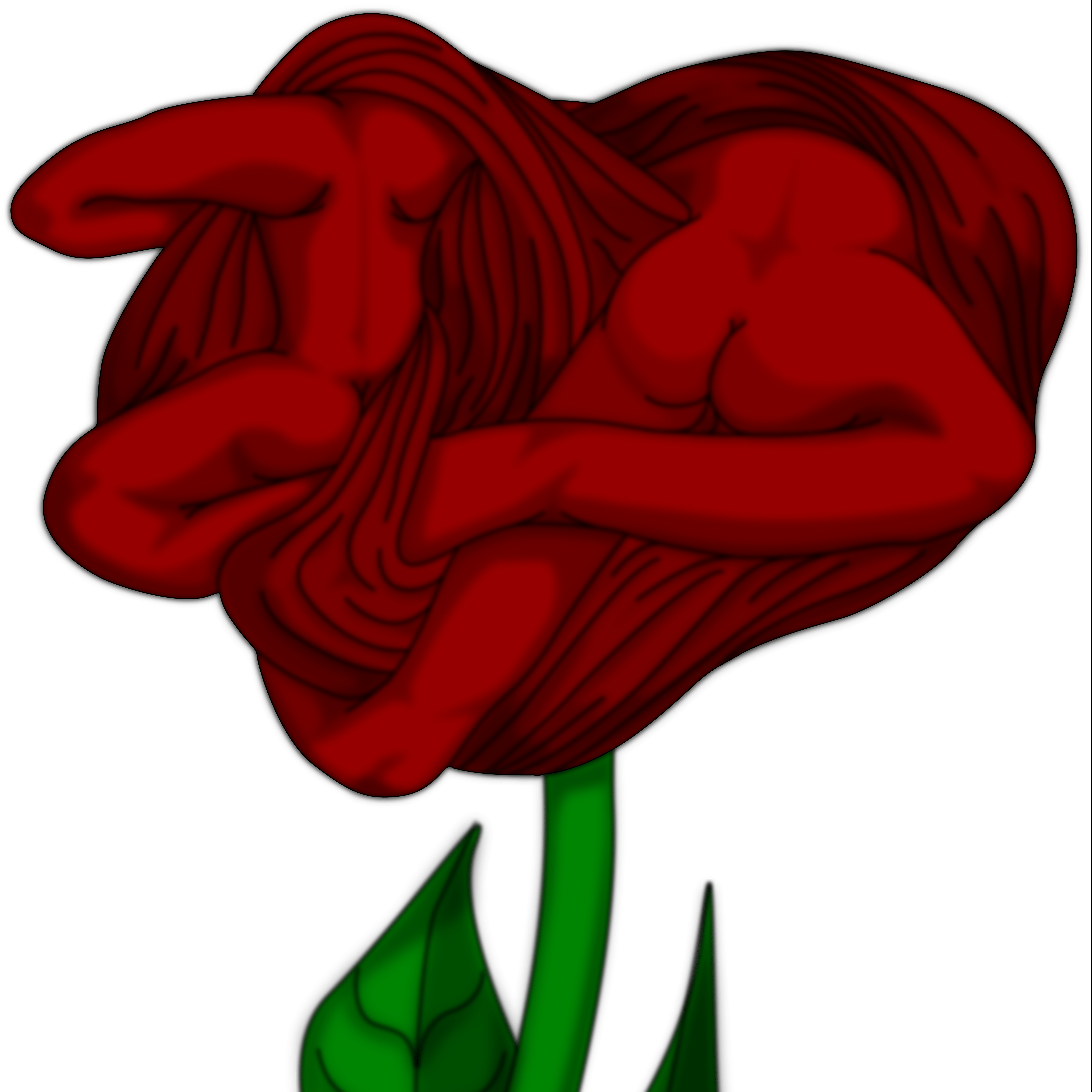
Schreibe einen Kommentar