Versuch eines Glaubensbekenntnisses
Sie kommen.
Sie nennen sie einen Sünder.
Und sie soll gerade dadurch als Ketzer erkannt werden, dass sie keine heilige Schrift besitzt.
Doch nun schreibt sie selbst.
Offenbart sich der Welt.So schreibt sie um ihr Leben, schreibt mit aller Leichtigkeit des Todgeweihten, um bloß noch fertig zu werden, ehe sie eintreffen.
Und schließlich, wenn sie hiernach vor ihr stehen, so wird sie auch in ihren Augen glauben – sie wird leben dürfen.Endlich, so ihre letzte Hoffnung in deren orthodoxe Toleranz, werden sie sie in Frieden lassen.
Renard Volant
Vielleicht sogar selbst da noch, wo sie ihren Gott verabscheut.
Ja, wir sind gläubig, die Commune Mondiale kennt das Religiöse.
Und dies ist ein Eingeständnis, das uns beiden durchaus schwergefallen ist. Aber so unterschiedlich unsere Motivationen zum (politischen) Atheismus auch waren, so einig sind wir uns nun in einigen Eckpunkten unseres gemeinsamen Glaubens an das Metaphysische, das durchaus nicht nur als Metapher unser Projektmotto ziert:
Welt, Mensch und Göttliches.
Abgrenzungen
Doch bevor wir inhaltlich auf die Fragen metaphysischer Dogmen in eigener Sache eingehen, müssen wir zunächst mit Abgrenzungen beginnen – mit den Gründen unserer Abkehr oder der Ablehnung traditioneller Religionen:
Denn von den monotheistischen Göttern personaler Natur hielten wir wohl nie sonderlich viel, wenngleich wir uns ihrer Mythen und Theologien, durch die Geschichte hindurch, durchaus bedienen mögen.
Nicht zuletzt aber die Theodizee, die empirische Kraft des Leides, wie auch die labyrinthischen Gedanken jener, die diese, in Annahme eines allmächtigen, wie allgütigen Gottes menschlichen Geistes, zu rechtfertigen suchten, erschien uns mit Nichten jemals als irgend lösbar. Die Freiheit des Menschen im Angesicht der zwieschlächtigen Natur, die gebiert, beschenkt, verstümmelt und tötet, kann uns aus diesem Blickwinkel bloß als intellektuelle Flucht vor der Kritik der Substanz (Spinoza) selbst erscheinen.
Und in der Tat, insbesondere die Vorwürfe des Judentums an ihre selbsternannten Nachfolger im Christentum, dass die Trinität Gottes wohl nichts weiter sein kann, als Rückfall in die Vielgötterei und Rekonkretisierung oder gar Vermenschlichung des Abstrakten, erachten wir als vollkommen gerecht.
Überhaupt stehen wir, trotz aller Distanz zur Idee des personalen Gottes, den polytheistischen Modellen der Religiosität noch ferner, als den abrahamitischen Varianten. Unsere Annahme des gemeinsamen Urgrunds kennt keine Konkurrenz zwischen Gleichen einer göttlichen Familie.
Der unitarische Ausspruch, „Gott ist einer“, kann und muss einzig für uns gelten, wenn wir anerkennen, dass die Naturgesetze ein einziges System bilden, aus dem kein Entkommen zu sein scheint.
Letztlich sind es aber auch Denker wie Feuerbach, Marx und Freud, die uns lehrten, dass jede Vorstellung eines konkret Göttlichen, auch da wo es dem vermeintlich objektiven Gesetze einer längst vergangenen Offenbarung gehorcht, rein projektiv ist. Sie folgt somit mehr den Gesetzen unserer sozialen Erfahrung im gesellschaftlich verursachten Mangelerleben oder gar der eigenen Libido und dem ozeanischen Gefühl im Schoße einer bald entfremdeten Mutter, vor Allem aber dem Tradierten und Verkommenen, als den Erfordernissen eines rationalen Denkens über das irdische Sein und darüber hinaus.
Und doch, so entlehnen wir uns des Bilderverbotes gegen Gott, wie es aus dem Judentum bekannt ist, um die negative Theologie eines Mosche Ben Maimon weiterzutreiben zu dem, was wir unsere negative Deologie nennen: Ein Glaube, vielmehr eine unbegründete Überzeugung aus Mangel an Erkenntnis, dass der erste Beweger (Aristoteles) übermenschlich, also überpersonal sein muss, will man tatsächlich einen Gottesbegriff beibehalten.
Warum Gott?
Doch warum überhaupt einen Gott?
Mark war es, der einmal zu Renard bemerkte, als er den x-ten lustigen Spruch aus den Reihen einer atheistischen Facebookgruppe gegenüber den so verschmähten Religiösen las, der nichts neues brachte als sich selbst bestätigende Überheblichkeit:
„Atheisten hatten eine gute Idee. Seitdem ruhen sie sich darauf aus.“
Denn natürlich bleibt die Frage: Nachdem wir in der Inventur des Kosmos bis zum Phantastischen eines schwarzen Loches mit dem Namen Phönix A und einer Masse von über 100 Milliarden Sonnen fortschritten, während wir zugleich mühselig daran knabberten, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik durch multidimensionale Strings zu vereinen – was blieb danach am Ende des Urknalls und jenseits des Big Crunch?
Eine Unwahrscheinliche Erscheinung, die doch nur deshalb nicht als unwahrscheinlich gelten kann, weil sie entweder aus einem unbekannten Zustande ohne irdisch gesetzmäßig-logischen Unterbau heraus entstanden sein muss oder weil sie dagegen in einem infiniten Regress aus Geburt und Vergehen vor sich her treibt, irgendwo zwischen Entropie und Komplexität, ewig oszillierend zwischen Inflation und Kontraktion.
Nein, es ist u.E. aus dieser Perspektive nicht irrationaler an einen Urgrund zu glauben, als den Zufall im Weniger als Nichts. Metaphysik bleibt somit im Streben des Menschsein begründet, als Spekulation und Ethik im leeren doch belebten Raum.
Eigenschaften Gottes
Wenn wir nun also sagen: Wir glauben an Gott, was genau ist es dann woran wir glauben?
Ist es die Substanz, die Natur, wie bei Spinoza? Ist es der Absolute Geist Hegels, oder die Idee Platons?
Die Antwort hierauf muss unbefriedigend bleiben, denn auch die Theodizee eines negativen, unpersonalen Gottes bleibt bestehen.
Wozu braucht der Deus ex Absurdo die Entropie um zu wachsen?
Wieso schaffen wir uns, als seine Kinder dagegen, Räume der Negentropie, um uns zu organisieren und um zu leben?
Es beschlich uns vom Standorte der Ohnmacht des Menschen, im Angesicht der eigenen Sterblichkeit, ein womöglich ebenso projektives Gefühl, wie wohl dem der vergangenen Generation zu ihrem Herrn, nun jedoch dem Universum gegenüber, wenn auch dieses kein besonders ehrfürchtiges war:
Vielleicht, so mussten wir fühlen, ist das All Gottes ebenso unfähig zur Erkenntnis und zur Unsterblichkeit, wie wir selbst es nicht einmal zustande bringen mögen, unseren inneren Haushalt zu einer ausgeglichen Psyche, die körperliche Vegetation zu einem gesunden Leib oder die äußere Ökonomie und Politik hin zu einer befriedeten, gerechten und freien Weltgesellschaft zu gestalten.
Und doch, wie Hegel anmerkte, ist ein Mensch, der bloß fühlte und sonst nichts, noch nicht fertig.
Das Gute, wie auch immer wir dieses mit Inhalt füllen mögen – so ist bei Renard zu lesen – muss dem Gotte somit als indifferent erscheinen, also als (noch) nicht relevant – oder aber als durch ihn selbst zwar irgendwie ‚gewollt‘, doch nicht unmittelbar zu erreichen.
Seine feindselig-feingeistige Ordnung erscheint hierbei als eine solche der Statik in seiner Dynamik, als eine kontingente Emergenz, als ein Mehr als die Summe seiner Teile, als ein dialektisches Fließen unter Bedingungen, die ihm noch immer nicht unterliegen, als ein unwillkürlicher Drive im zirkulären Drift, wobei von Unten her nicht unterschieden werden kann zwischen Schöpfung und Schöpfer, dabei zugleich ein Bewusstsein nur metaphysisch-metaphorisch angenommen werden kann und darf, wenn man das Denken denn ernst nähme.
Die Frage, die uns bleibt, ist also, ob das Universum nun selbst dieser Gott sei, das unbestimmte aber gesetzmäßig erfassbare Sein somit, welches kein Außerhalb des Selbst mehr kennt; oder ob der Schöpfer das Jenseitige an sich darstellt, somit das Negative der Existenz, das Außerhalb des Kosmos, Ein Sof im Zimzum, das uns Platz macht, um zu existieren.
Unsere Auffassung nun lässt beides zu:
Wir denken uns Gott daher als panendeistisch, aus Mangel an Möglichkeiten das Transzendente und Außenstehende der Natur zu erfahren und zu erkennen.
Das Kleine im Großen im absoluten Rätsel – Dieses alles nennen wir Gott.
Ethik und Mensch
Was aber heißt dies für uns Menschen?
Nun, wir stellen uns bewusst in die Tradition des Humanismus, der Aufklärung, der Haskala, des Fortschritts – in Liebe zur Vernunft, wenn auch im Eingedenken ihrer dialektischen Verstrickung mit der Natur.
Trotz aller Zweifel schließlich, aller Relativität und Zirkularität des Systems, aller Negativität der Totalität, lehnen wir den postmodernen Relativismus dabei ab.
Es gibt das Falsche für sich selbst. Dieses jedoch, als unmenschlich-Ungöttliches bloß deshalb, weil es dagegen das Richtige geben muss. Doch dieses Erste einzig setzen wir als Gegeben voraus – willkürlich, spekulativ, überzeugt.
Wenn auch aus dieser Annahme heraus das richtige Leben im Falschen unmöglich sei, wie Adorno es angesichts bürgerlicher Herrschaft formulierte, so ist das Richtige allerdings durchaus (negativ) denkbar.
So wäre dies Richtige, dereinst in die Realität geworfen, ein Akt der Befreiung und eine Verwirklichung des guten Gottes im Menschen, sowie auch die Shoah, der Krieg, das Elend, die Krankheit, die Folter und der Tod – sprich die verkehrte Vorgeschichte unserer Hoffnung – das Schlechte, das sich unser Gott dereinst abstreifen möge, wie einen Schuppenpanzer, der ihm zu klein geworden ist, um zu wachsen.
Der Kampf des Menschen gegen die Despotie, gegen Ideologie und Irrtum, wie auch gegen das Unmenschliche seiner eigenen Kultur und Ökonomie, ist demnach in letzter Instanz auch der Kampf Gottes gegen seine unvollkommene Jugend:
Die endgültige Überwindung der Entropie manifestiert sich in der Überwindung auch von thermischen Zuständen <77K und >174K für alles Leben.
Der Mensch kämpft so Seit an Seit mit Gott in sich, als Teil und Ergebnis desselben, zur Verwirklichung und weiteren Entwicklung, Kultivierung und Zivilisierung des Lebens.
Alles Mögliche und Unmögliche liegt diesem Kampfe inne:
Erkenntnis und Gestaltung der Komplexität zum Wohle des Menschen, wie auch die Medizin der Unsterblichkeit und die Politik der Befreiung. Diese Errungenschaften stellten die Versöhnung des Individuums mit dem Allgemeinen dar.
Zusammenfassung
Wir verbleiben so mit unserem Bekenntnis, dem Wesen unserer negativen Deologie, im Geiste eines zu sich selbst gekommenen Humanismus.
Unsere Religion ist der Odem des Diamodernismus, der die vergangenen Katastrophen erkennt und verurteilt, weil er sie begreift. Sie ist hierbei eine Prozessdeologie negativen Inhalts mit der Möglichkeit einer Entfaltung hin zum Paradiese.
Unser Glauben erscheint dabei als eine Praxis, die die erste Natur des Universums anbetet, um sie zu kritisieren und die zweite Natur menschlicher Gesellschaft kritisiert, um sie verehren zu können.
Wir glauben an das Verletzliche in Gott und das göttliche Potential in jedem Menschen.
Wir glauben an Rationalität und Wissenschaft, ebenso wie an die Tugend im Triebe und die Vernunft des Gefühls, letztlich auch an Kunst, Muße und Übermaß.
Wir glauben an das Denken, (Mit-)Fühlen und Erfassen.
Wir glauben an Freiheit, Gleichheit und Solidarität.
Wir glauben an das Unverzeihliche in der Evolution der Menschheit, des Lebens und des Universums.
Wir glauben an die manifeste Möglichkeit der Erlösung, an die irdisch-überirdische Jeshu’a, an die Verwirklichung Gottes.
Wir kämpfen für Welt, Mensch und Göttliches.
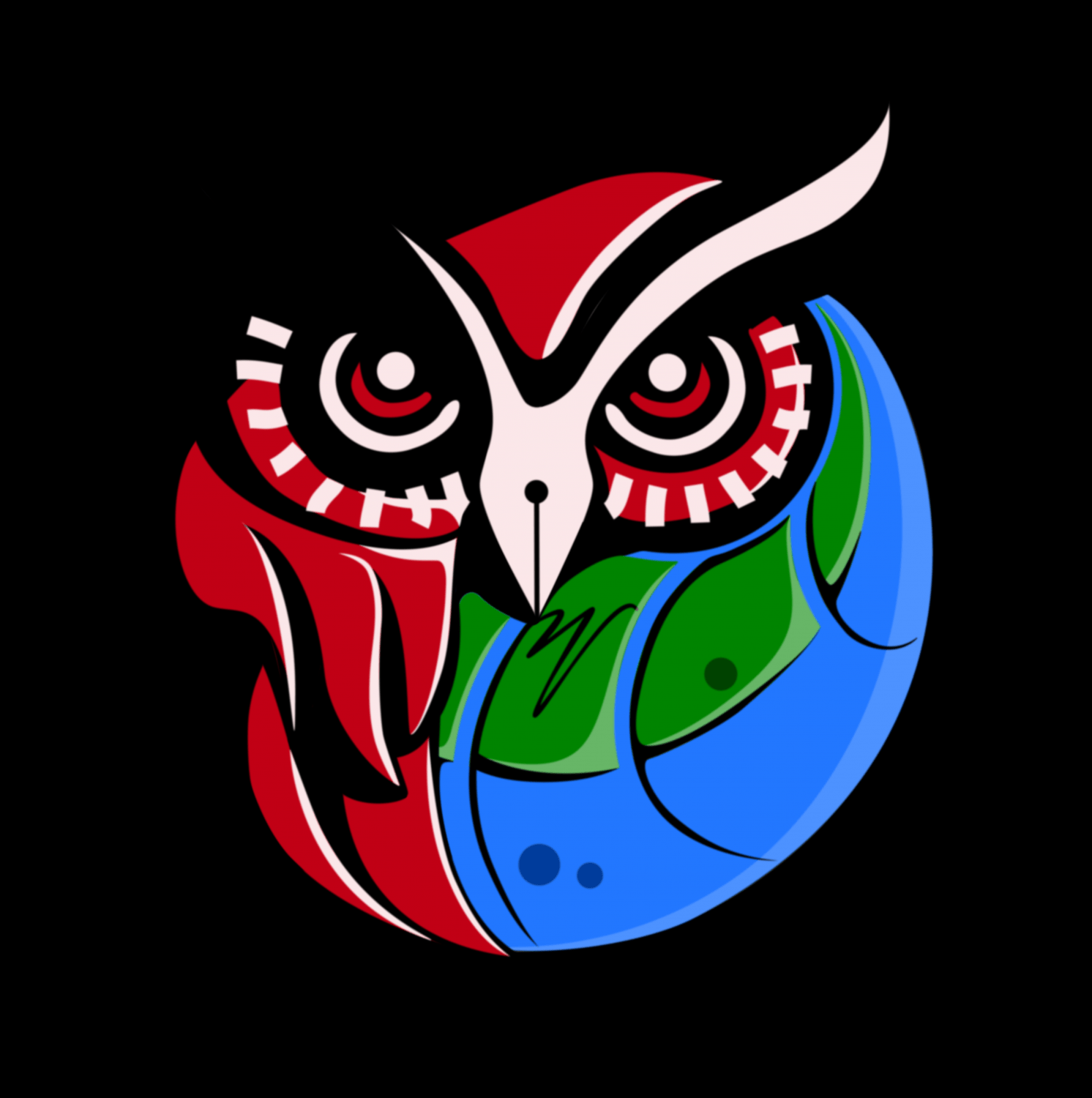
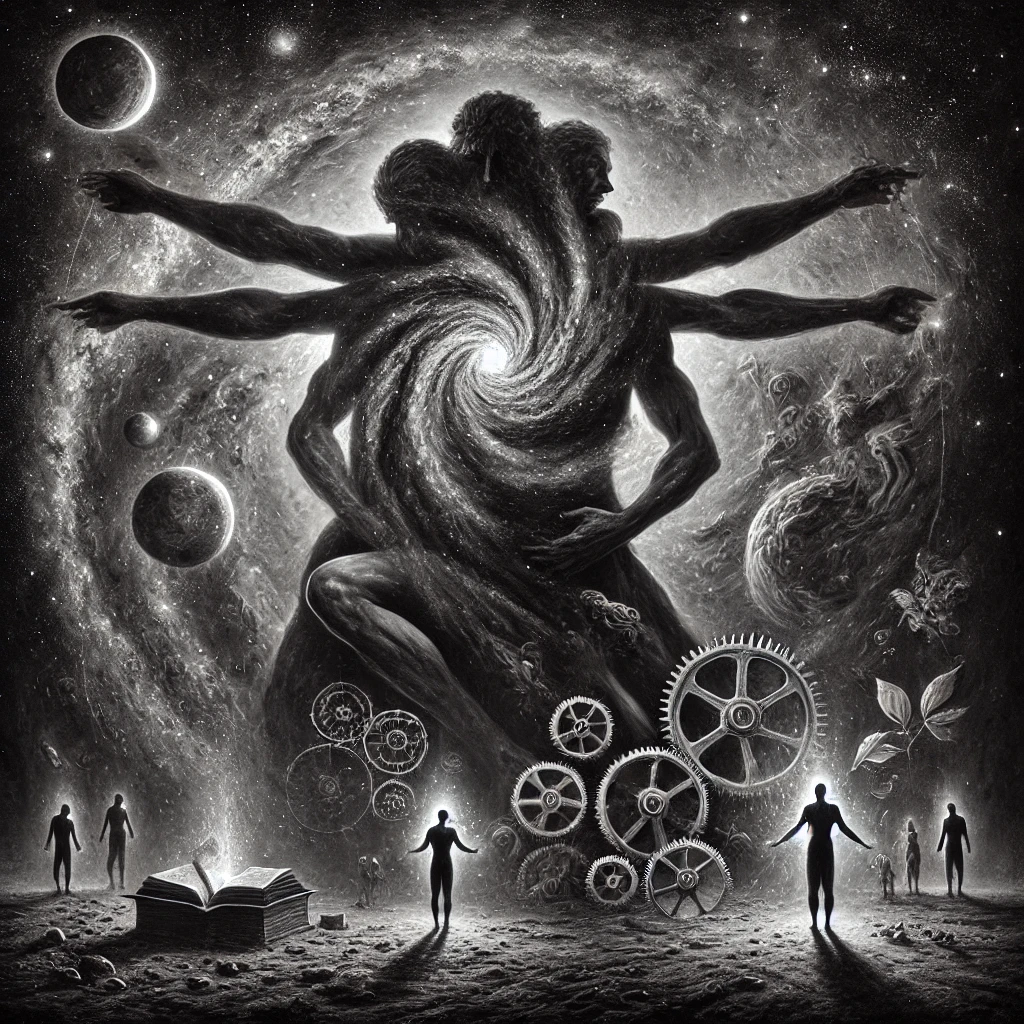
Schreibe einen Kommentar